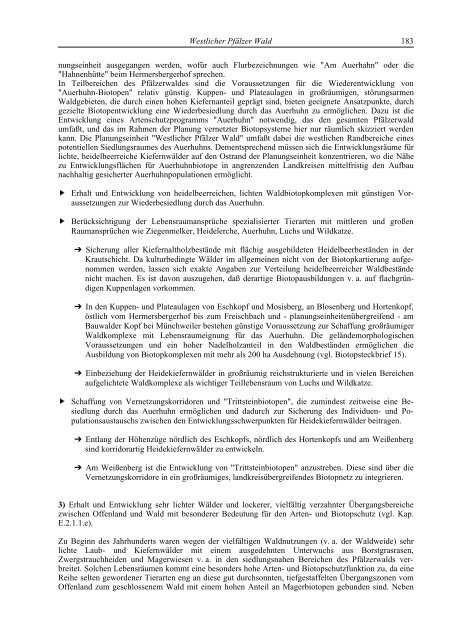Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Westlicher Pfälzer Wald 183<br />
nungseinheit ausgegangen werden, wofür auch Flurbezeichnungen wie "Am Auerhahn" oder die<br />
"Hahnenhütte" beim Hermersbergerhof sprechen.<br />
In Teilbereichen des Pfälzerwaldes sind die Voraussetzungen für die Wiederentwicklung von<br />
"Auerhuhn-Biotopen" relativ günstig. Kuppen- und Plateaulagen in großräumigen, störungsarmen<br />
Waldgebieten, die durch einen hohen Kiefernanteil geprägt sind, bieten geeignete Ansatzpunkte, durch<br />
gezielte Biotopentwicklung eine Wiederbesiedlung durch das Auerhuhn zu ermöglichen. Dazu ist die<br />
Entwicklung eines Artenschutzprogramms "Auerhuhn" notwendig, das den gesamten Pfälzerwald<br />
umfaßt, und das im Rahmen der <strong>Planung</strong> vernetzter <strong>Biotopsysteme</strong> hier nur räumlich skizziert werden<br />
kann. Die <strong>Planung</strong>seinheit "Westlicher Pfälzer Wald" umfaßt dabei die westlichen Randbereiche eines<br />
potentiellen Siedlungsraumes des Auerhuhns. Dementsprechend müssen sich die Entwicklungsräume für<br />
lichte, heidelbeerreiche Kiefernwälder auf den Ostrand der <strong>Planung</strong>seinheit konzentrieren, wo die Nähe<br />
zu Entwicklungsflächen für Auerhuhnbiotope in angrenzenden <strong>Landkreis</strong>en mittelfristig den Aufbau<br />
nachhaltig gesicherter Auerhuhnpopulationen ermöglicht.<br />
� Erhalt und Entwicklung von heidelbeerreichen, lichten Waldbiotopkomplexen mit günstigen Voraussetzungen<br />
zur Wiederbesiedlung durch das Auerhuhn.<br />
� Berücksichtigung der Lebensraumansprüche spezialisierter Tierarten mit mittleren und großen<br />
Raumansprüchen wie Ziegenmelker, Heidelerche, Auerhuhn, Luchs und Wildkatze.<br />
➔ Sicherung aller Kiefernaltholzbestände mit flächig ausgebildeten Heidelbeerbeständen in der<br />
Krautschicht. Da kulturbedingte Wälder im allgemeinen nicht von der Biotopkartierung aufgenommen<br />
werden, lassen sich exakte Angaben zur Verteilung heidelbeerreicher Waldbestände<br />
nicht machen. Es ist davon auszugehen, daß derartige Biotopausbildungen v. a. auf flachgründigen<br />
Kuppenlagen vorkommen.<br />
➔ In den Kuppen- und Plateaulagen von Eschkopf und Mosisberg, an Blosenberg und Hortenkopf,<br />
östlich vom Hermersbergerhof bis zum Freischbach und - planungseinheitenübergreifend - am<br />
Bauwalder Kopf bei Münchweiler bestehen günstige Voraussetzung zur Schaffung großräumiger<br />
Waldkomplexe mit Lebensraumeignung für das Auerhuhn. Die geländemorphologischen<br />
Voraussetzungen und ein hoher Nadelholzanteil in den Waldbeständen ermöglichen die<br />
Ausbildung von Biotopkomplexen mit mehr als 200 ha Ausdehnung (vgl. Biotopsteckbrief 15).<br />
➔ Einbeziehung der Heidekiefernwälder in großräumig reichstrukturierte und in vielen <strong>Bereich</strong>en<br />
aufgelichtete Waldkomplexe als wichtiger Teillebensraum von Luchs und Wildkatze.<br />
� Schaffung von Vernetzungskorridoren und "Trittsteinbiotopen", die zumindest zeitweise eine Besiedlung<br />
durch das Auerhuhn ermöglichen und dadurch zur Sicherung des Individuen- und Populationsaustauschs<br />
zwischen den Entwicklungsschwerpunkten für Heidekiefernwälder beitragen.<br />
➔ Entlang der Höhenzüge nördlich des Eschkopfs, nördlich des Hortenkopfs und am Weißenberg<br />
sind korridorartig Heidekiefernwälder zu entwickeln.<br />
➔ Am Weißenberg ist die Entwicklung von "Trittsteinbiotopen" anzustreben. Diese sind über die<br />
Vernetzungskorridore in ein großräumiges, landkreisübergreifendes Biotopnetz zu integrieren.<br />
3) Erhalt und Entwicklung sehr lichter Wälder und lockerer, vielfältig verzahnter Übergangsbereiche<br />
zwischen Offenland und Wald mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz (vgl. Kap.<br />
E.2.1.1.e).<br />
Zu Beginn des Jahrhunderts waren wegen der vielfältigen Waldnutzungen (v. a. der Waldweide) sehr<br />
lichte Laub- und Kiefernwälder mit einem ausgedehnten Unterwuchs aus Borstgrasrasen,<br />
Zwergstrauchheiden und Magerwiesen v. a. in den siedlungsnahen <strong>Bereich</strong>en des Pfälzerwalds verbreitet.<br />
Solchen Lebensräumen kommt eine besonders hohe Arten- und Biotopschutzfunktion zu, da eine<br />
Reihe selten gewordener Tierarten eng an diese gut durchsonnten, tiefgestaffelten Übergangszonen vom<br />
Offenland zum geschlossenem Wald mit einem hohen Anteil an Magerbiotopen gebunden sind. Neben