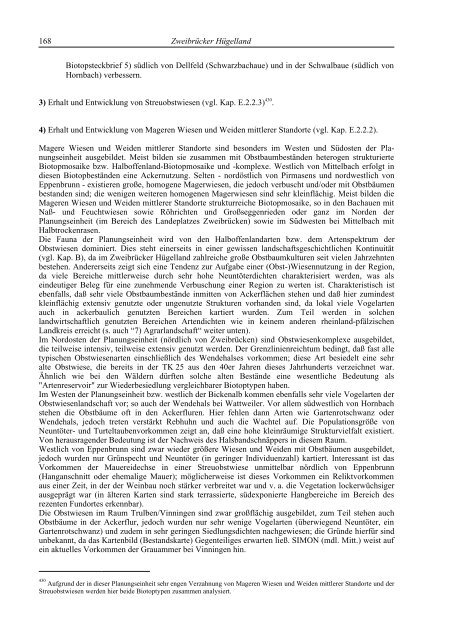Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
168 Zweibrücker Hügelland<br />
Biotopsteckbrief 5) südlich von Dellfeld (Schwarzbachaue) und in der Schwalbaue (südlich von<br />
Hornbach) verbessern.<br />
3) Erhalt und Entwicklung von Streuobstwiesen (vgl. Kap. E.2.2.3) 430 .<br />
4) Erhalt und Entwicklung von Mageren Wiesen und Weiden mittlerer Standorte (vgl. Kap. E.2.2.2).<br />
Magere Wiesen und Weiden mittlerer Standorte sind besonders im Westen und Südosten der <strong>Planung</strong>seinheit<br />
ausgebildet. Meist bilden sie zusammen mit Obstbaumbeständen heterogen strukturierte<br />
Biotopmosaike bzw. Halboffenland-Biotopmosaike und -komplexe. Westlich von Mittelbach erfolgt in<br />
diesen Biotopbeständen eine Ackernutzung. Selten - nordöstlich von Pirmasens und nordwestlich von<br />
Eppenbrunn - existieren große, homogene Magerwiesen, die jedoch verbuscht und/oder mit Obstbäumen<br />
bestanden sind; die wenigen weiteren homogenen Magerwiesen sind sehr kleinflächig. Meist bilden die<br />
Mageren Wiesen und Weiden mittlerer Standorte strukturreiche Biotopmosaike, so in den Bachauen mit<br />
Naß- und Feuchtwiesen sowie Röhrichten und Großseggenrieden oder ganz im Norden der<br />
<strong>Planung</strong>seinheit (im <strong>Bereich</strong> des Landeplatzes Zweibrücken) sowie im Südwesten bei Mittelbach mit<br />
Halbtrockenrasen.<br />
Die Fauna der <strong>Planung</strong>seinheit wird von den Halboffenlandarten bzw. dem Artenspektrum der<br />
Obstwiesen dominiert. Dies steht einerseits in einer gewissen landschaftsgeschichtlichen Kontinuität<br />
(vgl. Kap. B), da im Zweibrücker Hügelland zahlreiche große Obstbaumkulturen seit vielen Jahrzehnten<br />
bestehen. Andererseits zeigt sich eine Tendenz zur Aufgabe einer (Obst-)Wiesennutzung in der Region,<br />
da viele <strong>Bereich</strong>e mittlerweise durch sehr hohe Neuntöterdichten charakterisiert werden, was als<br />
eindeutiger Beleg für eine zunehmende Verbuschung einer Region zu werten ist. Charakteristisch ist<br />
ebenfalls, daß sehr viele Obstbaumbestände inmitten von Ackerflächen stehen und daß hier zumindest<br />
kleinflächig extensiv genutzte oder ungenutzte Strukturen vorhanden sind, da lokal viele Vogelarten<br />
auch in ackerbaulich genutzten <strong>Bereich</strong>en kartiert wurden. Zum Teil werden in solchen<br />
landwirtschaftlich genutzten <strong>Bereich</strong>en Artendichten wie in keinem anderen rheinland-pfälzischen<br />
<strong>Landkreis</strong> erreicht (s. auch “7) Agrarlandschaft“ weiter unten).<br />
Im Nordosten der <strong>Planung</strong>seinheit (nördlich von Zweibrücken) sind Obstwiesenkomplexe ausgebildet,<br />
die teilweise intensiv, teilweise extensiv genutzt werden. Der Grenzlinienreichtum bedingt, daß fast alle<br />
typischen Obstwiesenarten einschließlich des Wendehalses vorkommen; diese Art besiedelt eine sehr<br />
alte Obstwiese, die bereits in der TK 25 aus den 40er Jahren dieses Jahrhunderts verzeichnet war.<br />
Ähnlich wie bei den Wäldern dürften solche alten Bestände eine wesentliche Bedeutung als<br />
"Artenreservoir" zur Wiederbesiedlung vergleichbarer Biotoptypen haben.<br />
Im Westen der <strong>Planung</strong>seinheit bzw. westlich der Bickenalb kommen ebenfalls sehr viele Vogelarten der<br />
Obstwiesenlandschaft vor; so auch der Wendehals bei Wattweiler. Vor allem südwestlich von Hornbach<br />
stehen die Obstbäume oft in den Ackerfluren. Hier fehlen dann Arten wie Gartenrotschwanz oder<br />
Wendehals, jedoch treten verstärkt Rebhuhn und auch die Wachtel auf. Die Populationsgröße von<br />
Neuntöter- und Turteltaubenvorkommen zeigt an, daß eine hohe kleinräumige Strukturvielfalt existiert.<br />
Von herausragender Bedeutung ist der Nachweis des Halsbandschnäppers in diesem Raum.<br />
Westlich von Eppenbrunn sind zwar wieder größere Wiesen und Weiden mit Obstbäumen ausgebildet,<br />
jedoch wurden nur Grünspecht und Neuntöter (in geringer Individuenzahl) kartiert. Interessant ist das<br />
Vorkommen der Mauereidechse in einer Streuobstwiese unmittelbar nördlich von Eppenbrunn<br />
(Hanganschnitt oder ehemalige Mauer); möglicherweise ist dieses Vorkommen ein Reliktvorkommen<br />
aus einer Zeit, in der der Weinbau noch stärker verbreitet war und v. a. die Vegetation lockerwüchsiger<br />
ausgeprägt war (in älteren Karten sind stark terrassierte, südexponierte Hangbereiche im <strong>Bereich</strong> des<br />
rezenten Fundortes erkennbar).<br />
Die Obstwiesen im Raum Trulben/Vinningen sind zwar großflächig ausgebildet, zum Teil stehen auch<br />
Obstbäume in der Ackerflur, jedoch wurden nur sehr wenige Vogelarten (überwiegend Neuntöter, ein<br />
Gartenrotschwanz) und zudem in sehr geringen Siedlungsdichten nachgewiesen; die Gründe hierfür sind<br />
unbekannt, da das Kartenbild (Bestandskarte) Gegenteiliges erwarten ließ. SIMON (mdl. Mitt.) weist auf<br />
ein aktuelles Vorkommen der Grauammer bei Vinningen hin.<br />
430 Aufgrund der in dieser <strong>Planung</strong>seinheit sehr engen Verzahnung von Mageren Wiesen und Weiden mittlerer Standorte und der<br />
Streuobstwiesen werden hier beide Biotoptypen zusammen analysiert.