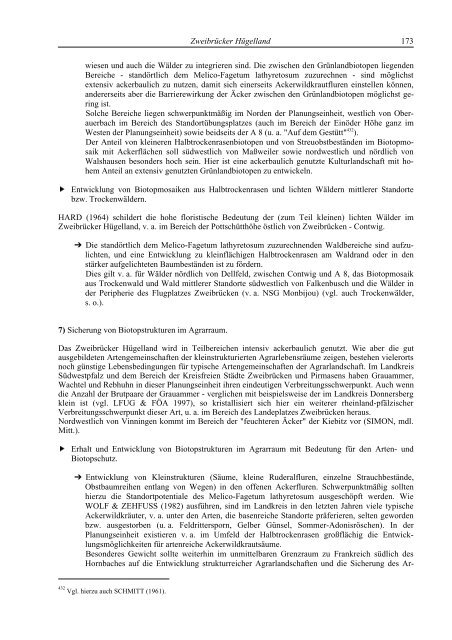Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Zweibrücker Hügelland 173<br />
wiesen und auch die Wälder zu integrieren sind. Die zwischen den Grünlandbiotopen liegenden<br />
<strong>Bereich</strong>e - standörtlich dem Melico-Fagetum lathyretosum zuzurechnen - sind möglichst<br />
extensiv ackerbaulich zu nutzen, damit sich einerseits Ackerwildkrautfluren einstellen können,<br />
andererseits aber die Barrierewirkung der Äcker zwischen den Grünlandbiotopen möglichst gering<br />
ist.<br />
Solche <strong>Bereich</strong>e liegen schwerpunktmäßig im Norden der <strong>Planung</strong>seinheit, westlich von Oberauerbach<br />
im <strong>Bereich</strong> des Standortübungsplatzes (auch im <strong>Bereich</strong> der Einöder Höhe ganz im<br />
Westen der <strong>Planung</strong>seinheit) sowie beidseits der A 8 (u. a. "Auf dem Gestütt" 432 ).<br />
Der Anteil von kleineren Halbtrockenrasenbiotopen und von Streuobstbeständen im Biotopmosaik<br />
mit Ackerflächen soll südwestlich von Maßweiler sowie nordwestlich und nördlich von<br />
Walshausen besonders hoch sein. Hier ist eine ackerbaulich genutzte Kulturlandschaft mit hohem<br />
Anteil an extensiv genutzten Grünlandbiotopen zu entwickeln.<br />
� Entwicklung von Biotopmosaiken aus Halbtrockenrasen und lichten Wäldern mittlerer Standorte<br />
bzw. Trockenwäldern.<br />
HARD (1964) schildert die hohe floristische Bedeutung der (zum Teil kleinen) lichten Wälder im<br />
Zweibrücker Hügelland, v. a. im <strong>Bereich</strong> der Pottschütthöhe östlich von Zweibrücken - Contwig.<br />
➔ Die standörtlich dem Melico-Fagetum lathyretosum zuzurechnenden Waldbereiche sind aufzulichten,<br />
und eine Entwicklung zu kleinflächigen Halbtrockenrasen am Waldrand oder in den<br />
stärker aufgelichteten Baumbeständen ist zu fördern.<br />
Dies gilt v. a. für Wälder nördlich von Dellfeld, zwischen Contwig und A 8, das Biotopmosaik<br />
aus Trockenwald und Wald mittlerer Standorte südwestlich von Falkenbusch und die Wälder in<br />
der Peripherie des Flugplatzes Zweibrücken (v. a. NSG Monbijou) (vgl. auch Trockenwälder,<br />
s. o.).<br />
7) Sicherung von Biotopstrukturen im Agrarraum.<br />
Das Zweibrücker Hügelland wird in Teilbereichen intensiv ackerbaulich genutzt. Wie aber die gut<br />
ausgebildeten Artengemeinschaften der kleinstrukturierten Agrarlebensräume zeigen, bestehen vielerorts<br />
noch günstige Lebensbedingungen für typische Artengemeinschaften der Agrarlandschaft. Im <strong>Landkreis</strong><br />
<strong>Südwestpfalz</strong> und dem <strong>Bereich</strong> der Kreisfreien Städte Zweibrücken und Pirmasens haben Grauammer,<br />
Wachtel und Rebhuhn in dieser <strong>Planung</strong>seinheit ihren eindeutigen Verbreitungsschwerpunkt. Auch wenn<br />
die Anzahl der Brutpaare der Grauammer - verglichen mit beispielsweise der im <strong>Landkreis</strong> Donnersberg<br />
klein ist (vgl. LFUG & FÖA 1997), so kristallisiert sich hier ein weiterer rheinland-pfälzischer<br />
Verbreitungsschwerpunkt dieser Art, u. a. im <strong>Bereich</strong> des Landeplatzes Zweibrücken heraus.<br />
Nordwestlich von Vinningen kommt im <strong>Bereich</strong> der "feuchteren Äcker" der Kiebitz vor (SIMON, mdl.<br />
Mitt.).<br />
� Erhalt und Entwicklung von Biotopstrukturen im Agrarraum mit Bedeutung für den Arten- und<br />
Biotopschutz.<br />
➔ Entwicklung von Kleinstrukturen (Säume, kleine Ruderalfluren, einzelne Strauchbestände,<br />
Obstbaumreihen entlang von Wegen) in den offenen Ackerfluren. Schwerpunktmäßig sollten<br />
hierzu die Standortpotentiale des Melico-Fagetum lathyretosum ausgeschöpft werden. Wie<br />
WOLF & ZEHFUSS (1982) ausführen, sind im <strong>Landkreis</strong> in den letzten Jahren viele typische<br />
Ackerwildkräuter, v. a. unter den Arten, die basenreiche Standorte präferieren, selten geworden<br />
bzw. ausgestorben (u. a. Feldrittersporn, Gelber Günsel, Sommer-Adonisröschen). In der<br />
<strong>Planung</strong>seinheit existieren v. a. im Umfeld der Halbtrockenrasen großflächig die Entwicklungsmöglichkeiten<br />
für artenreiche Ackerwildkrautsäume.<br />
Besonderes Gewicht sollte weiterhin im unmittelbaren Grenzraum zu Frankreich südlich des<br />
Hornbaches auf die Entwicklung strukturreicher Agrarlandschaften und die Sicherung des Ar-<br />
432 Vgl. hierzu auch SCHMITT (1961).