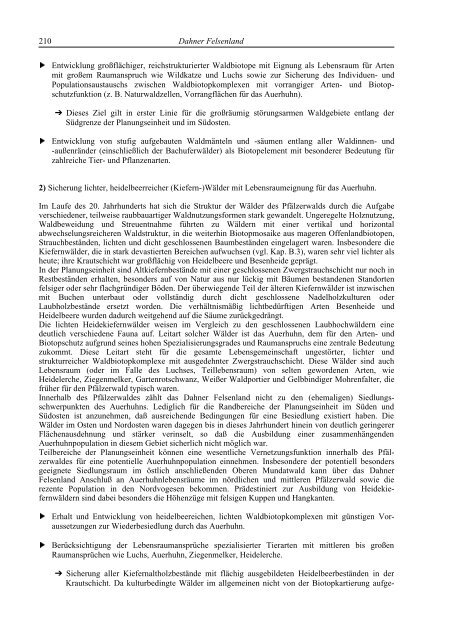Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
210 Dahner Felsenland<br />
� Entwicklung großflächiger, reichstrukturierter Waldbiotope mit Eignung als Lebensraum für Arten<br />
mit großem Raumanspruch wie Wildkatze und Luchs sowie zur Sicherung des Individuen- und<br />
Populationsaustauschs zwischen Waldbiotopkomplexen mit vorrangiger Arten- und Biotopschutzfunktion<br />
(z. B. Naturwaldzellen, Vorrangflächen für das Auerhuhn).<br />
➔ Dieses Ziel gilt in erster Linie für die großräumig störungsarmen Waldgebiete entlang der<br />
Südgrenze der <strong>Planung</strong>seinheit und im Südosten.<br />
� Entwicklung von stufig aufgebauten Waldmänteln und -säumen entlang aller Waldinnen- und<br />
-außenränder (einschließlich der Bachuferwälder) als Biotopelement mit besonderer Bedeutung für<br />
zahlreiche Tier- und Pflanzenarten.<br />
2) Sicherung lichter, heidelbeerreicher (Kiefern-)Wälder mit Lebensraumeignung für das Auerhuhn.<br />
Im Laufe des 20. Jahrhunderts hat sich die Struktur der Wälder des Pfälzerwalds durch die Aufgabe<br />
verschiedener, teilweise raubbauartiger Waldnutzungsformen stark gewandelt. Ungeregelte Holznutzung,<br />
Waldbeweidung und Streuentnahme führten zu Wäldern mit einer vertikal und horizontal<br />
abwechselungsreicheren Waldstruktur, in die weiterhin Biotopmosaike aus mageren Offenlandbiotopen,<br />
Strauchbeständen, lichten und dicht geschlossenen Baumbeständen eingelagert waren. Insbesondere die<br />
Kiefernwälder, die in stark devastierten <strong>Bereich</strong>en aufwuchsen (vgl. Kap. B.3), waren sehr viel lichter als<br />
heute; ihre Krautschicht war großflächig von Heidelbeere und Besenheide geprägt.<br />
In der <strong>Planung</strong>seinheit sind Altkiefernbestände mit einer geschlossenen Zwergstrauchschicht nur noch in<br />
Restbeständen erhalten, besonders auf von Natur aus nur lückig mit Bäumen bestandenen Standorten<br />
felsiger oder sehr flachgründiger Böden. Der überwiegende Teil der älteren Kiefernwälder ist inzwischen<br />
mit Buchen unterbaut oder vollständig durch dicht geschlossene Nadelholzkulturen oder<br />
Laubholzbestände ersetzt worden. Die verhältnismäßig lichtbedürftigen Arten Besenheide und<br />
Heidelbeere wurden dadurch weitgehend auf die Säume zurückgedrängt.<br />
Die lichten Heidekiefernwälder weisen im Vergleich zu den geschlossenen Laubhochwäldern eine<br />
deutlich verschiedene Fauna auf. Leitart solcher Wälder ist das Auerhuhn, dem für den Arten- und<br />
Biotopschutz aufgrund seines hohen Spezialisierungsgrades und Raumanspruchs eine zentrale Bedeutung<br />
zukommt. Diese Leitart steht für die gesamte Lebensgemeinschaft ungestörter, lichter und<br />
strukturreicher Waldbiotopkomplexe mit ausgedehnter Zwergstrauchschicht. Diese Wälder sind auch<br />
Lebensraum (oder im Falle des Luchses, Teillebensraum) von selten gewordenen Arten, wie<br />
Heidelerche, Ziegenmelker, Gartenrotschwanz, Weißer Waldportier und Gelbbindiger Mohrenfalter, die<br />
früher für den Pfälzerwald typisch waren.<br />
Innerhalb des Pfälzerwaldes zählt das Dahner Felsenland nicht zu den (ehemaligen) Siedlungsschwerpunkten<br />
des Auerhuhns. Lediglich für die Randbereiche der <strong>Planung</strong>seinheit im Süden und<br />
Südosten ist anzunehmen, daß ausreichende Bedingungen für eine Besiedlung existiert haben. Die<br />
Wälder im Osten und Nordosten waren dagegen bis in dieses Jahrhundert hinein von deutlich geringerer<br />
Flächenausdehnung und stärker verinselt, so daß die Ausbildung einer zusammenhängenden<br />
Auerhuhnpopulation in diesem Gebiet sicherlich nicht möglich war.<br />
Teilbereiche der <strong>Planung</strong>seinheit können eine wesentliche Vernetzungsfunktion innerhalb des Pfälzerwaldes<br />
für eine potentielle Auerhuhnpopulation einnehmen. Insbesondere der potentiell besonders<br />
geeignete Siedlungsraum im östlich anschließenden Oberen Mundatwald kann über das Dahner<br />
Felsenland Anschluß an Auerhuhnlebensräume im nördlichen und mittleren Pfälzerwald sowie die<br />
rezente Population in den Nordvogesen bekommen. Prädestiniert zur Ausbildung von Heidekiefernwäldern<br />
sind dabei besonders die Höhenzüge mit felsigen Kuppen und Hangkanten.<br />
� Erhalt und Entwicklung von heidelbeereichen, lichten Waldbiotopkomplexen mit günstigen Voraussetzungen<br />
zur Wiederbesiedlung durch das Auerhuhn.<br />
� Berücksichtigung der Lebensraumansprüche spezialisierter Tierarten mit mittleren bis großen<br />
Raumansprüchen wie Luchs, Auerhuhn, Ziegenmelker, Heidelerche.<br />
➔ Sicherung aller Kiefernaltholzbestände mit flächig ausgebildeten Heidelbeerbeständen in der<br />
Krautschicht. Da kulturbedingte Wälder im allgemeinen nicht von der Biotopkartierung aufge-