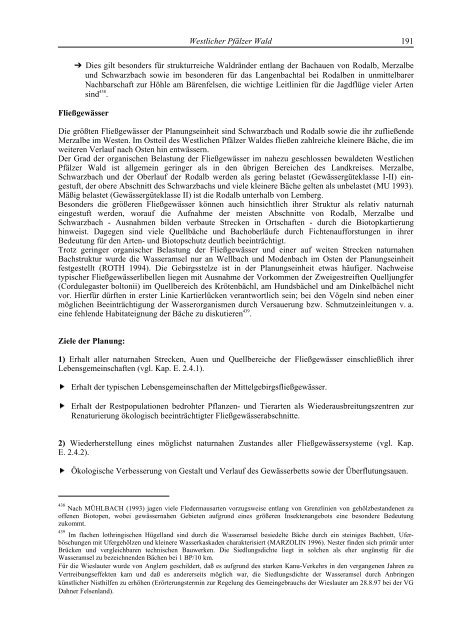Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Westlicher Pfälzer Wald 191<br />
➔ Dies gilt besonders für strukturreiche Waldränder entlang der Bachauen von Rodalb, Merzalbe<br />
und Schwarzbach sowie im besonderen für das Langenbachtal bei Rodalben in unmittelbarer<br />
Nachbarschaft zur Höhle am Bärenfelsen, die wichtige Leitlinien für die Jagdflüge vieler Arten<br />
sind 438 .<br />
Fließgewässer<br />
Die größten Fließgewässer der <strong>Planung</strong>seinheit sind Schwarzbach und Rodalb sowie die ihr zufließende<br />
Merzalbe im Westen. Im Ostteil des Westlichen Pfälzer Waldes fließen zahlreiche kleinere Bäche, die im<br />
weiteren Verlauf nach Osten hin entwässern.<br />
Der Grad der organischen Belastung der Fließgewässer im nahezu geschlossen bewaldeten Westlichen<br />
Pfälzer Wald ist allgemein geringer als in den übrigen <strong>Bereich</strong>en des <strong>Landkreis</strong>es. Merzalbe,<br />
Schwarzbach und der Oberlauf der Rodalb werden als gering belastet (Gewässergüteklasse I-II) eingestuft,<br />
der obere Abschnitt des Schwarzbachs und viele kleinere Bäche gelten als unbelastet (MU 1993).<br />
Mäßig belastet (Gewässergüteklasse II) ist die Rodalb unterhalb von Lemberg.<br />
Besonders die größeren Fließgewässer können auch hinsichtlich ihrer Struktur als relativ naturnah<br />
eingestuft werden, worauf die Aufnahme der meisten Abschnitte von Rodalb, Merzalbe und<br />
Schwarzbach - Ausnahmen bilden verbaute Strecken in Ortschaften - durch die Biotopkartierung<br />
hinweist. Dagegen sind viele Quellbäche und Bachoberläufe durch Fichtenaufforstungen in ihrer<br />
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz deutlich beeinträchtigt.<br />
Trotz geringer organischer Belastung der Fließgewässer und einer auf weiten Strecken naturnahen<br />
Bachstruktur wurde die Wasseramsel nur an Wellbach und Modenbach im Osten der <strong>Planung</strong>seinheit<br />
festgestellt (ROTH 1994). Die Gebirgsstelze ist in der <strong>Planung</strong>seinheit etwas häufiger. Nachweise<br />
typischer Fließgewässerlibellen liegen mit Ausnahme der Vorkommen der Zweigestreiften Quelljungfer<br />
(Cordulegaster boltonii) im Quellbereich des Krötenbächl, am Hundsbächel und am Dinkelbächel nicht<br />
vor. Hierfür dürften in erster Linie Kartierlücken verantwortlich sein; bei den Vögeln sind neben einer<br />
möglichen Beeinträchtigung der Wasserorganismen durch Versauerung bzw. Schmutzeinleitungen v. a.<br />
eine fehlende Habitateignung der Bäche zu diskutieren 439 .<br />
Ziele der <strong>Planung</strong>:<br />
1) Erhalt aller naturnahen Strecken, Auen und Quellbereiche der Fließgewässer einschließlich ihrer<br />
Lebensgemeinschaften (vgl. Kap. E. 2.4.1).<br />
� Erhalt der typischen Lebensgemeinschaften der Mittelgebirgsfließgewässer.<br />
� Erhalt der Restpopulationen bedrohter Pflanzen- und Tierarten als Wiederausbreitungszentren zur<br />
Renaturierung ökologisch beeinträchtigter Fließgewässerabschnitte.<br />
2) Wiederherstellung eines möglichst naturnahen Zustandes aller Fließgewässersysteme (vgl. Kap.<br />
E. 2.4.2).<br />
� Ökologische Verbesserung von Gestalt und Verlauf des Gewässerbetts sowie der Überflutungsauen.<br />
438<br />
Nach MÜHLBACH (1993) jagen viele Fledermausarten vorzugsweise entlang von Grenzlinien von gehölzbestandenen zu<br />
offenen Biotopen, wobei gewässernahen Gebieten aufgrund eines größeren Insektenangebots eine besondere Bedeutung<br />
zukommt.<br />
439<br />
Im flachen lothringischen Hügelland sind durch die Wasseramsel besiedelte Bäche durch ein steiniges Bachbett, Uferböschungen<br />
mit Ufergehölzen und kleinere Wasserkaskaden charakterisiert (MARZOLIN 1996). Nester finden sich primär unter<br />
Brücken und vergleichbaren technischen Bauwerken. Die Siedlungsdichte liegt in solchen als eher ungünstig für die<br />
Wasseramsel zu bezeichnenden Bächen bei 1 BP/10 km.<br />
Für die Wieslauter wurde von Anglern geschildert, daß es aufgrund des starken Kanu-Verkehrs in den vergangenen Jahren zu<br />
Vertreibungseffekten kam und daß es andererseits möglich war, die Siedlungsdichte der Wasseramsel durch Anbringen<br />
künstlicher Nisthilfen zu erhöhen (Erörterungstermin zur Regelung des Gemeingebrauchs der Wieslauter am 28.8.97 bei der VG<br />
Dahner Felsenland).