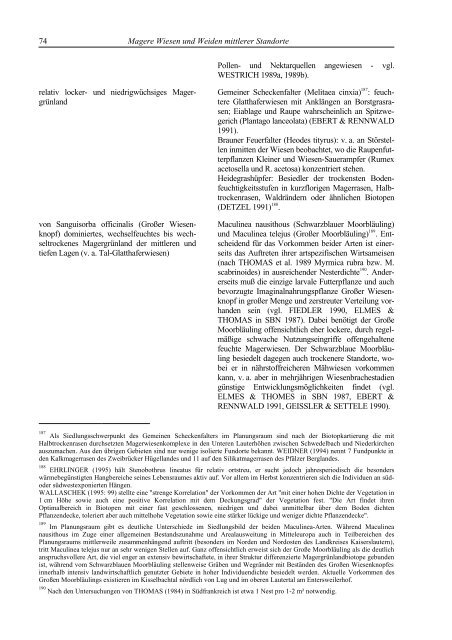Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
74 Magere Wiesen und Weiden mittlerer Standorte<br />
relativ locker- und niedrigwüchsiges Magergrünland<br />
von Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf)<br />
dominiertes, wechselfeuchtes bis wechseltrockenes<br />
Magergrünland der mittleren und<br />
tiefen Lagen (v. a. Tal-Glatthaferwiesen)<br />
Pollen- und Nektarquellen angewiesen - vgl.<br />
WESTRICH 1989a, 1989b).<br />
Gemeiner Scheckenfalter (Melitaea cinxia) 187 : feuchtere<br />
Glatthaferwiesen mit Anklängen an Borstgrasrasen;<br />
Eiablage und Raupe wahrscheinlich an Spitzwegerich<br />
(Plantago lanceolata) (EBERT & RENNWALD<br />
1991).<br />
Brauner Feuerfalter (Heodes tityrus): v. a. an Störstellen<br />
inmitten der Wiesen beobachtet, wo die Raupenfutterpflanzen<br />
Kleiner und Wiesen-Sauerampfer (Rumex<br />
acetosella und R. acetosa) konzentriert stehen.<br />
Heidegrashüpfer: Besiedler der trockensten Bodenfeuchtigkeitsstufen<br />
in kurzflorigen Magerrasen, Halbtrockenrasen,<br />
Waldrändern oder ähnlichen Biotopen<br />
(DETZEL 1991) 188 .<br />
Maculinea nausithous (Schwarzblauer Moorbläuling)<br />
und Maculinea telejus (Großer Moorbläuling) 189 . Entscheidend<br />
für das Vorkommen beider Arten ist einerseits<br />
das Auftreten ihrer artspezifischen Wirtsameisen<br />
(nach THOMAS et al. 1989 Myrmica rubra bzw. M.<br />
scabrinoides) in ausreichender Nesterdichte 190 . Andererseits<br />
muß die einzige larvale Futterpflanze und auch<br />
bevorzugte Imaginalnahrungspflanze Großer Wiesenknopf<br />
in großer Menge und zerstreuter Verteilung vorhanden<br />
sein (vgl. FIEDLER 1990, ELMES &<br />
THOMAS in SBN 1987). Dabei benötigt der Große<br />
Moorbläuling offensichtlich eher lockere, durch regelmäßige<br />
schwache Nutzungseingriffe offengehaltene<br />
feuchte Magerwiesen. Der Schwarzblaue Moorbläuling<br />
besiedelt dagegen auch trockenere Standorte, wobei<br />
er in nährstoffreicheren Mähwiesen vorkommen<br />
kann, v. a. aber in mehrjährigen Wiesenbrachestadien<br />
günstige Entwicklungsmöglichkeiten findet (vgl.<br />
ELMES & THOMES in SBN 1987, EBERT &<br />
RENNWALD 1991, GEISSLER & SETTELE 1990).<br />
187<br />
Als Siedlungsschwerpunkt des Gemeinen Scheckenfalters im <strong>Planung</strong>sraum sind nach der Biotopkartierung die mit<br />
Halbtrockenrasen durchsetzten Magerwiesenkomplexe in den Unteren Lauterhöhen zwischen Schwedelbach und Niederkirchen<br />
auszumachen. Aus den übrigen Gebieten sind nur wenige isolierte Fundorte bekannt. WEIDNER (1994) nennt 7 Fundpunkte in<br />
den Kalkmagerrasen des Zweibrücker Hügellandes und 11 auf den Silikatmagerrasen des Pfälzer Berglandes.<br />
188<br />
EHRLINGER (1995) hält Stenobothrus lineatus für relativ ortstreu, er sucht jedoch jahresperiodisch die besonders<br />
wärmebegünstigten Hangbereiche seines Lebensraumes aktiv auf. Vor allem im Herbst konzentrieren sich die Individuen an südoder<br />
südwestexponierten Hängen.<br />
WALLASCHEK (1995: 99) stellte eine "strenge Korrelation" der Vorkommen der Art "mit einer hohen Dichte der Vegetation in<br />
1 cm Höhe sowie auch eine positive Korrelation mit dem Deckungsgrad" der Vegetation fest. "Die Art findet ihren<br />
Optimalbereich in Biotopen mit einer fast geschlossenen, niedrigen und dabei unmittelbar über dem Boden dichten<br />
Pflanzendecke, toleriert aber auch mittelhohe Vegetation sowie eine stärker lückige und weniger dichte Pflanzendecke".<br />
189<br />
Im <strong>Planung</strong>sraum gibt es deutliche Unterschiede im Siedlungsbild der beiden Maculinea-Arten. Während Maculinea<br />
nausithous im Zuge einer allgemeinen Bestandszunahme und Arealausweitung in Mitteleuropa auch in Teilbereichen des<br />
<strong>Planung</strong>sraums mittlerweile zusammenhängend auftritt (besonders im Norden und Nordosten des <strong>Landkreis</strong>es Kaiserslautern),<br />
tritt Maculinea telejus nur an sehr wenigen Stellen auf. Ganz offensichtlich erweist sich der Große Moorbläuling als die deutlich<br />
anspruchsvollere Art, die viel enger an extensiv bewirtschaftete, in ihrer Struktur differenzierte Magergrünlandbiotope gebunden<br />
ist, während vom Schwarzblauen Moorbläuling stellenweise Gräben und Wegränder mit Beständen des Großen Wiesenknopfes<br />
innerhalb intensiv landwirtschaftlich genutzter Gebiete in hoher Individuendichte besiedelt werden. Aktuelle Vorkommen des<br />
Großen Moorbläulings existieren im Kisselbachtal nördlich von Lug und im oberen Lautertal am Entersweilerhof.<br />
190<br />
Nach den Untersuchungen von THOMAS (1984) in Südfrankreich ist etwa 1 Nest pro 1-2 m² notwendig.