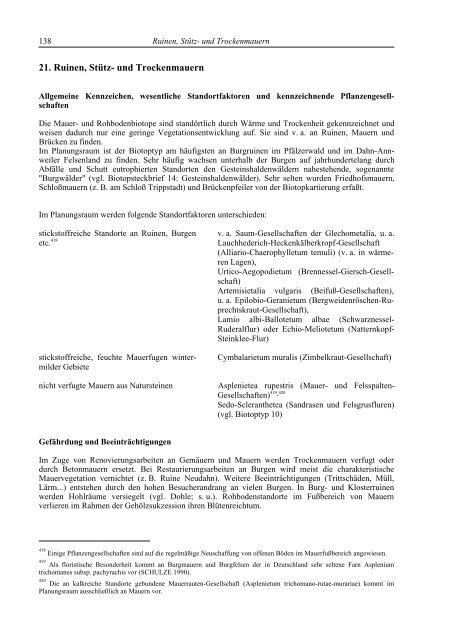- Seite 1 und 2:
Impressum Planung Vernetzter Biotop
- Seite 3 und 4:
Inhalt I Inhalt Seite A. Einleitung
- Seite 5 und 6:
Verzeichnis der Abbildungen und Tab
- Seite 7 und 8:
A. Einleitung A.1 Zielsetzung Ziels
- Seite 9 und 10:
Zielsetzung 3 � Sie stellt die r
- Seite 11 und 12:
3. Darstellung des Bestandes a. Bes
- Seite 13 und 14:
Zur Darstellung der Ziele stehen dr
- Seite 15 und 16:
Hinweise zur Benutzung 9 charakteri
- Seite 17 und 18:
Naturräumliche Ausstattung 11 B.2
- Seite 19 und 20:
Naturräumliche Ausstattung 13 teil
- Seite 21 und 22:
Entstehung und Entwicklung der Kult
- Seite 23 und 24:
Entstehung und Entwicklung der Kult
- Seite 25 und 26:
Entstehung und Entwicklung der Kult
- Seite 27 und 28:
Entstehung und Entwicklung der Kult
- Seite 29 und 30:
Entstehung und Entwicklung der Kult
- Seite 31 und 32:
Entstehung und Entwicklung der Kult
- Seite 33 und 34:
Entstehung und Entwicklung der Kult
- Seite 35 und 36:
Entstehung und Entwicklung der Kult
- Seite 37 und 38:
Als landkreiskennzeichnende Arten w
- Seite 39 und 40:
Landkreiskennzeichnende Tierarten 3
- Seite 41 und 42:
Landkreiskennzeichnende Tierarten 3
- Seite 43 und 44:
Streuobstwiesen und Halboffenlandbi
- Seite 45 und 46:
Landkreiskennzeichnende Tierarten 3
- Seite 47 und 48:
Gefährdung und Beeinträchtigungen
- Seite 49 und 50:
Quellen und Quellbäche 43 Larvenpo
- Seite 51 und 52:
Gefährdung und Beeinträchtigungen
- Seite 53 und 54:
Bäche und Bachuferwälder 47 Pestw
- Seite 55 und 56:
3. Tümpel, Weiher und Teiche Tümp
- Seite 57 und 58:
Biotop- und Raumansprüche Tümpel,
- Seite 59 und 60:
Tümpel: Tümpel, Weiher und Teiche
- Seite 61 und 62:
4. Naß- und Feuchtwiesen, Kleinseg
- Seite 63 und 64:
Gefährdung und Beeinträchtigungen
- Seite 65 und 66:
Naß- und Feuchtwiesen, Kleinseggen
- Seite 67 und 68:
Naß- und Feuchtwiesen, Kleinseggen
- Seite 69 und 70:
5. Röhrichte und Großseggenriede
- Seite 71 und 72:
Röhrichte und Großseggenriede 65
- Seite 73 und 74:
Zusammenfassende Bewertung Die biot
- Seite 75 und 76:
Gefährdung und Beeinträchtigungen
- Seite 77 und 78:
Vernetzungsbeziehungen besonderer f
- Seite 79 und 80:
Fettweiden (Cynosurion) colline bis
- Seite 81 und 82:
Magere Wiesen und Weiden mittlerer
- Seite 83 und 84:
8. Wiesen und Weiden mittlerer Stan
- Seite 85 und 86:
Zielgrößen der Planung Wiesen und
- Seite 87 und 88:
Halbtrockenrasen und Weinbergsbrach
- Seite 89 und 90:
Halbtrockenrasen und Weinbergsbrach
- Seite 91 und 92:
Trockenrasen, (trocken-warme) Felse
- Seite 93 und 94: Trockenrasen, (trocken-warme) Felse
- Seite 95 und 96: Trockenrasen, (trocken-warme) Felse
- Seite 97 und 98: Zwergstrauchheiden (Genistion) und
- Seite 99 und 100: mit Calluna-Beständen vernetzte Be
- Seite 101 und 102: Vernetzungsbeziehungen besonderer f
- Seite 103 und 104: Lungenenzian-Bestände in Pfeifengr
- Seite 105 und 106: 13. Trockenwälder Trockenwälder 9
- Seite 107 und 108: Trockenwälder 101 BUSSLER (1990, 1
- Seite 109 und 110: Trockenwälder 103 In optimal ausge
- Seite 111 und 112: 14. Gesteinshaldenwälder Gesteinsh
- Seite 113 und 114: Zielgrößen der Planung Gesteinsha
- Seite 115 und 116: sommerwarme, trockenere und basenre
- Seite 117 und 118: lichte Laubwaldflächen frischer St
- Seite 119 und 120: lichte Kiefernwälder 330 mit Kahls
- Seite 121 und 122: Laubwälder mittlerer Standorte und
- Seite 123 und 124: Zielgrößen der Planung Laubwälde
- Seite 125 und 126: Bruch- und Sumpfwälder 119 Talrand
- Seite 127 und 128: 17. Strauchbestände Strauchbestän
- Seite 129 und 130: Strauchbestände 123 angrenzende He
- Seite 131 und 132: Strauchbestände 125 Landschaft ori
- Seite 133 und 134: Streuobstbestände 127 ULLRICH 1975
- Seite 135 und 136: Streuobstbestände 129 Da Streuobst
- Seite 137 und 138: Pioniervegetation und Ruderalfluren
- Seite 139 und 140: Pioniervegetation und Ruderalfluren
- Seite 141 und 142: Pioniervegetation und Ruderalfluren
- Seite 143: Höhlen und Stollen 137 Kleinlebens
- Seite 147 und 148: D. Planungsziele D.1 Zielkategorien
- Seite 149 und 150: Zielkategorien 143 Nicht flächensc
- Seite 151 und 152: Allgemeine Ziele 145 Borstgrasrasen
- Seite 153 und 154: Ziele der Planung: Sickinger Höhe
- Seite 155 und 156: Wiesen und Weiden, Äcker Sickinger
- Seite 157 und 158: Sickinger Höhe 151 Biotopschutzbed
- Seite 159 und 160: Sickinger Höhe 153 � Berücksich
- Seite 161 und 162: Sickinger Höhe 155 Ganz im Norden
- Seite 163 und 164: Fließgewässer Sickinger Höhe 157
- Seite 165 und 166: Sickinger Höhe 159 der Biotopkarti
- Seite 167 und 168: Ziele der Planung: Zweibrücker Hü
- Seite 169 und 170: Zweibrücker Hügelland 163 gemeins
- Seite 171 und 172: Zweibrücker Hügelland 165 Tagfalt
- Seite 173 und 174: Zweibrücker Hügelland 167 ausgebi
- Seite 175 und 176: Zweibrücker Hügelland 169 Der Rau
- Seite 177 und 178: Zweibrücker Hügelland 171 steller
- Seite 179 und 180: Zweibrücker Hügelland 173 wiesen
- Seite 181 und 182: Zweibrücker Hügelland 175 � Ent
- Seite 183 und 184: Zweibrücker Hügelland 177 2) Wied
- Seite 185 und 186: 2) Entwicklung von Stütz- und Troc
- Seite 187 und 188: Westlicher Pfälzer Wald 181 Der la
- Seite 189 und 190: Westlicher Pfälzer Wald 183 nungse
- Seite 191 und 192: Westlicher Pfälzer Wald 185 ➔ Di
- Seite 193 und 194: Westlicher Pfälzer Wald 187 Besond
- Seite 195 und 196:
Westlicher Pfälzer Wald 189 an den
- Seite 197 und 198:
Westlicher Pfälzer Wald 191 ➔ Di
- Seite 199 und 200:
D. 2.2.4 Planungseinheit Bergland d
- Seite 201 und 202:
Bergland der oberen Lauter 195 am G
- Seite 203 und 204:
Bergland der oberen Lauter 197 an g
- Seite 205 und 206:
Wiesen, Weiden und Äcker Bergland
- Seite 207 und 208:
Bergland der oberen Lauter 201 ➔
- Seite 209 und 210:
Bergland der oberen Lauter 203 den
- Seite 211 und 212:
Bergland der oberen Lauter 205 �
- Seite 213 und 214:
Bergland der oberen Lauter 207 woog
- Seite 215 und 216:
Ziele der Planung: Dahner Felsenlan
- Seite 217 und 218:
Dahner Felsenland 211 nommen werden
- Seite 219 und 220:
Dahner Felsenland 213 5) Erhalt und
- Seite 221 und 222:
Dahner Felsenland 215 ➔ Die Entwi
- Seite 223 und 224:
moorkomplexen. Dahner Felsenland 21
- Seite 225 und 226:
Dahner Felsenland 219 � Erhalt un
- Seite 227 und 228:
Dahner Felsenland 221 Vor allem die
- Seite 229 und 230:
� Förderung der natürlichen gew
- Seite 231 und 232:
Prioritäten 225 E. Hinweise für d
- Seite 233 und 234:
Prioritäten 227 entwicklung eine W
- Seite 235 und 236:
Prioritäten 229 Die Artengemeinsch
- Seite 237 und 238:
) Entwicklung großflächiger Waldb
- Seite 239 und 240:
3. Biotoptypenverträgliche Bewirts
- Seite 241 und 242:
3. Erhalt und Entwicklung von Streu
- Seite 243 und 244:
3. Erhalt und Entwicklung von Borst
- Seite 245 und 246:
2. Erhalt und Entwicklung von Bioto
- Seite 247 und 248:
Flächenankauf Instrumentarien der
- Seite 249 und 250:
Untersuchungsbedarf 243 Die Entwick
- Seite 251 und 252:
Literatur 245 Bauer, K.M. & U. Glut
- Seite 253 und 254:
Literatur 247 Bourn, N.A.D. & J.A.
- Seite 255 und 256:
Literatur 249 Cherrill, A.J. & V.K.
- Seite 257 und 258:
Literatur 251 Fiedler, K. & U. Masc
- Seite 259 und 260:
Literatur 253 Geiser, R. (o. J.): Z
- Seite 261 und 262:
Literatur 255 Häberle, D. (1913):
- Seite 263 und 264:
Literatur 257 Hoch, K. (1968): Die
- Seite 265 und 266:
Literatur 259 Klaus, S. & T. Stede
- Seite 267 und 268:
Literatur 261 Lange-Eichholz, J. (1
- Seite 269 und 270:
Literatur 263 Malkus, J. (1997): Ha
- Seite 271 und 272:
Literatur 265 Naumann, C.M. & K. Wi
- Seite 273 und 274:
Literatur 267 Pelz, G.R. (1989): Fr
- Seite 275 und 276:
Literatur 269 Ruthsatz, B. (1989):
- Seite 277 und 278:
Literatur 271 Schulte, G. (1982): B
- Seite 279 und 280:
Literatur 273 Stahlberg-Meinhardt,
- Seite 281 und 282:
Literatur 275 Vogel, M. (1985): Das
- Seite 283 und 284:
Literatur 277 Welling, M. (1987): U
- Seite 285 und 286:
G. Anhang Anhang 279
- Seite 287 und 288:
Kartier- Einheit HpnV Biotoptyp VBS
- Seite 289 und 290:
Kartier- Einheit HpnV BD/ BDa/ BDi/
- Seite 291 und 292:
Kartier- Einheit HpnV HAu/ HAru Bio
- Seite 293 und 294:
Kartier- Einheit HpnV Biotoptyp VBS
- Seite 295 und 296:
Anhang 289 Abb. 2: Verteilung ausge
- Seite 297 und 298:
Anhang 291 Abb. 4: Verteilung ausge
- Seite 299 und 300:
Anhang 293 Abb. 6: Waldbereiche mit
- Seite 301 und 302:
Anhang: Auswahl biotoptypischer fau
- Seite 303 und 304:
Anhang: Auswahl biotoptypischer fau
- Seite 305 und 306:
Anhang: Auswahl biotoptypischer fau
- Seite 307 und 308:
Anhang: Auswahl biotoptypischer fau
- Seite 309:
Anhang: Auswahl biotoptypischer fau