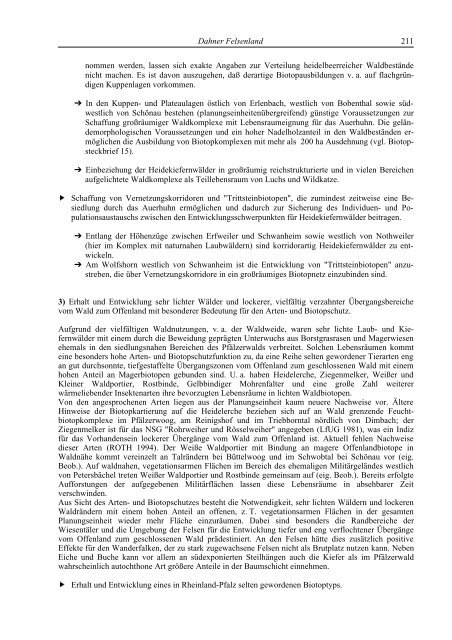Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Dahner Felsenland 211<br />
nommen werden, lassen sich exakte Angaben zur Verteilung heidelbeerreicher Waldbestände<br />
nicht machen. Es ist davon auszugehen, daß derartige Biotopausbildungen v. a. auf flachgründigen<br />
Kuppenlagen vorkommen.<br />
➔ In den Kuppen- und Plateaulagen östlich von Erlenbach, westlich von Bobenthal sowie südwestlich<br />
von Schönau bestehen (planungseinheitenübergreifend) günstige Voraussetzungen zur<br />
Schaffung großräumiger Waldkomplexe mit Lebensraumeignung für das Auerhuhn. Die geländemorphologischen<br />
Voraussetzungen und ein hoher Nadelholzanteil in den Waldbeständen ermöglichen<br />
die Ausbildung von Biotopkomplexen mit mehr als 200 ha Ausdehnung (vgl. Biotopsteckbrief<br />
15).<br />
➔ Einbeziehung der Heidekiefernwälder in großräumig reichstrukturierte und in vielen <strong>Bereich</strong>en<br />
aufgelichtete Waldkomplexe als Teillebensraum von Luchs und Wildkatze.<br />
� Schaffung von Vernetzungskorridoren und "Trittsteinbiotopen", die zumindest zeitweise eine Besiedlung<br />
durch das Auerhuhn ermöglichen und dadurch zur Sicherung des Individuen- und Populationsaustauschs<br />
zwischen den Entwicklungsschwerpunkten für Heidekiefernwälder beitragen.<br />
➔ Entlang der Höhenzüge zwischen Erfweiler und Schwanheim sowie westlich von Nothweiler<br />
(hier im Komplex mit naturnahen Laubwäldern) sind korridorartig Heidekiefernwälder zu entwickeln.<br />
➔ Am Wolfshorn westlich von Schwanheim ist die Entwicklung von "Trittsteinbiotopen" anzustreben,<br />
die über Vernetzungskorridore in ein großräumiges Biotopnetz einzubinden sind.<br />
3) Erhalt und Entwicklung sehr lichter Wälder und lockerer, vielfältig verzahnter Übergangsbereiche<br />
vom Wald zum Offenland mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
Aufgrund der vielfältigen Waldnutzungen, v. a. der Waldweide, waren sehr lichte Laub- und Kiefernwälder<br />
mit einem durch die Beweidung geprägten Unterwuchs aus Borstgrasrasen und Magerwiesen<br />
ehemals in den siedlungsnahen <strong>Bereich</strong>en des Pfälzerwalds verbreitet. Solchen Lebensräumen kommt<br />
eine besonders hohe Arten- und Biotopschutzfunktion zu, da eine Reihe selten gewordener Tierarten eng<br />
an gut durchsonnte, tiefgestaffelte Übergangszonen vom Offenland zum geschlossenen Wald mit einem<br />
hohen Anteil an Magerbiotopen gebunden sind. U. a. haben Heidelerche, Ziegenmelker, Weißer und<br />
Kleiner Waldportier, Rostbinde, Gelbbindiger Mohrenfalter und eine große Zahl weiterer<br />
wärmeliebender Insektenarten ihre bevorzugten Lebensräume in lichten Waldbiotopen.<br />
Von den angesprochenen Arten liegen aus der <strong>Planung</strong>seinheit kaum neuere Nachweise vor. Ältere<br />
Hinweise der Biotopkartierung auf die Heidelerche beziehen sich auf an Wald grenzende Feuchtbiotopkomplexe<br />
im Pfälzerwoog, am Reinigshof und im Triebborntal nördlich von Dimbach; der<br />
Ziegenmelker ist für das NSG "Rohrweiher und Rösselweiher" angegeben (LfUG 1981), was ein Indiz<br />
für das Vorhandensein lockerer Übergänge vom Wald zum Offenland ist. Aktuell fehlen Nachweise<br />
dieser Arten (ROTH 1994). Der Weiße Waldportier mit Bindung an magere Offenlandbiotope in<br />
Waldnähe kommt vereinzelt an Talrändern bei Büttelwoog und im Schwobtal bei Schönau vor (eig.<br />
Beob.). Auf waldnahen, vegetationsarmen Flächen im <strong>Bereich</strong> des ehemaligen Militärgeländes westlich<br />
von Petersbächel treten Weißer Waldportier und Rostbinde gemeinsam auf (eig. Beob.). Bereits erfolgte<br />
Aufforstungen der aufgegebenen Militärflächen lassen diese Lebensräume in absehbarer Zeit<br />
verschwinden.<br />
Aus Sicht des Arten- und Biotopschutzes besteht die Notwendigkeit, sehr lichten Wäldern und lockeren<br />
Waldrändern mit einem hohen Anteil an offenen, z. T. vegetationsarmen Flächen in der gesamten<br />
<strong>Planung</strong>seinheit wieder mehr Fläche einzuräumen. Dabei sind besonders die Randbereiche der<br />
Wiesentäler und die Umgebung der Felsen für die Entwicklung tiefer und eng verflochtener Übergänge<br />
vom Offenland zum geschlossenen Wald prädestiniert. An den Felsen hätte dies zusätzlich positive<br />
Effekte für den Wanderfalken, der zu stark zugewachsene Felsen nicht als Brutplatz nutzen kann. Neben<br />
Eiche und Buche kann vor allem an südexponierten Steilhängen auch die Kiefer als im Pfälzerwald<br />
wahrscheinlich autochthone Art größere Anteile in der Baumschicht einnehmen.<br />
� Erhalt und Entwicklung eines in Rheinland-Pfalz selten gewordenen Biotoptyps.