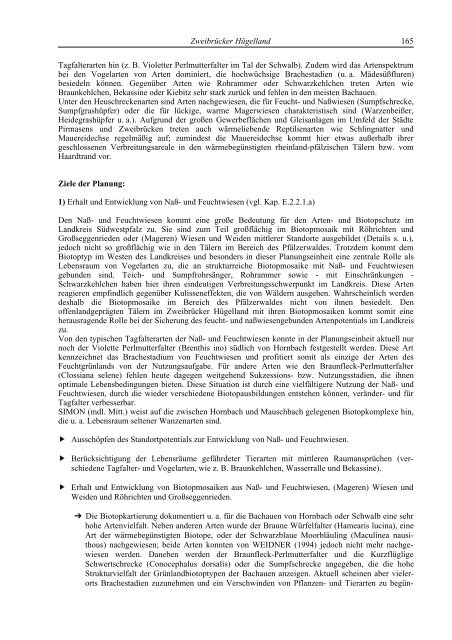Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Zweibrücker Hügelland 165<br />
Tagfalterarten hin (z. B. Violetter Perlmutterfalter im Tal der Schwalb). Zudem wird das Artenspektrum<br />
bei den Vogelarten von Arten dominiert, die hochwüchsige Brachestadien (u. a. Mädesüßfluren)<br />
besiedeln können. Gegenüber Arten wie Rohrammer oder Schwarzkehlchen treten Arten wie<br />
Braunkehlchen, Bekassine oder Kiebitz sehr stark zurück und fehlen in den meisten Bachauen.<br />
Unter den Heuschreckenarten sind Arten nachgewiesen, die für Feucht- und Naßwiesen (Sumpfschrecke,<br />
Sumpfgrashüpfer) oder die für lückige, warme Magerwiesen charakteristisch sind (Warzenbeißer,<br />
Heidegrashüpfer u. a.). Aufgrund der großen Gewerbeflächen und Gleisanlagen im Umfeld der Städte<br />
Pirmasens und Zweibrücken treten auch wärmeliebende Reptilienarten wie Schlingnatter und<br />
Mauereidechse regelmäßig auf; zumindest die Mauereidechse kommt hier etwas außerhalb ihrer<br />
geschlossenen Verbreitungsareale in den wärmebegünstigten rheinland-pfälzischen Tälern bzw. vom<br />
Haardtrand vor.<br />
Ziele der <strong>Planung</strong>:<br />
1) Erhalt und Entwicklung von Naß- und Feuchtwiesen (vgl. Kap. E.2.2.1.a)<br />
Den Naß- und Feuchtwiesen kommt eine große Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz im<br />
<strong>Landkreis</strong> <strong>Südwestpfalz</strong> zu. Sie sind zum Teil großflächig im Biotopmosaik mit Röhrichten und<br />
Großseggenrieden oder (Mageren) Wiesen und Weiden mittlerer Standorte ausgebildet (Details s. u.),<br />
jedoch nicht so großflächig wie in den Tälern im <strong>Bereich</strong> des Pfälzerwaldes. Trotzdem kommt dem<br />
Biotoptyp im Westen des <strong>Landkreis</strong>es und besonders in dieser <strong>Planung</strong>seinheit eine zentrale Rolle als<br />
Lebensraum von Vogelarten zu, die an strukturreiche Biotopmosaike mit Naß- und Feuchtwiesen<br />
gebunden sind. Teich- und Sumpfrohrsänger, Rohrammer sowie - mit Einschränkungen -<br />
Schwarzkehlchen haben hier ihren eindeutigen Verbreitungsschwerpunkt im <strong>Landkreis</strong>. Diese Arten<br />
reagieren empfindlich gegenüber Kulisseneffekten, die von Wäldern ausgehen. Wahrscheinlich werden<br />
deshalb die Biotopmosaike im <strong>Bereich</strong> des Pfälzerwaldes nicht von ihnen besiedelt. Den<br />
offenlandgeprägten Tälern im Zweibrücker Hügelland mit ihren Biotopmosaiken kommt somit eine<br />
herausragende Rolle bei der Sicherung des feucht- und naßwiesengebunden Artenpotentials im <strong>Landkreis</strong><br />
zu.<br />
Von den typischen Tagfalterarten der Naß- und Feuchtwiesen konnte in der <strong>Planung</strong>seinheit aktuell nur<br />
noch der Violette Perlmutterfalter (Brenthis ino) südlich von Hornbach festgestellt werden. Diese Art<br />
kennzeichnet das Brachestadium von Feuchtwiesen und profitiert somit als einzige der Arten des<br />
Feuchtgrünlands von der Nutzungsaufgabe. Für andere Arten wie den Braunfleck-Perlmutterfalter<br />
(Clossiana selene) fehlen heute dagegen weitgehend Sukzessions- bzw. Nutzungsstadien, die ihnen<br />
optimale Lebensbedingungen bieten. Diese Situation ist durch eine vielfältigere Nutzung der Naß- und<br />
Feuchtwiesen, durch die wieder verschiedene Biotopausbildungen entstehen können, veränder- und für<br />
Tagfalter verbesserbar.<br />
SIMON (mdl. Mitt.) weist auf die zwischen Hornbach und Mauschbach gelegenen Biotopkomplexe hin,<br />
die u. a. Lebensraum seltener Wanzenarten sind.<br />
� Ausschöpfen des Standortpotentials zur Entwicklung von Naß- und Feuchtwiesen.<br />
� Berücksichtigung der Lebensräume gefährdeter Tierarten mit mittleren Raumansprüchen (verschiedene<br />
Tagfalter- und Vogelarten, wie z. B. Braunkehlchen, Wasserralle und Bekassine).<br />
� Erhalt und Entwicklung von Biotopmosaiken aus Naß- und Feuchtwiesen, (Mageren) Wiesen und<br />
Weiden und Röhrichten und Großseggenrieden.<br />
➔ Die Biotopkartierung dokumentiert u. a. für die Bachauen von Hornbach oder Schwalb eine sehr<br />
hohe Artenvielfalt. Neben anderen Arten wurde der Braune Würfelfalter (Hamearis lucina), eine<br />
Art der wärmebegünstigten Biotope, oder der Schwarzblaue Moorbläuling (Maculinea nausithous)<br />
nachgewiesen; beide Arten konnten von WEIDNER (1994) jedoch nicht mehr nachgewiesen<br />
werden. Daneben werden der Braunfleck-Perlmutterfalter und die Kurzflüglige<br />
Schwertschrecke (Conocephalus dorsalis) oder die Sumpfschrecke angegeben, die die hohe<br />
Strukturvielfalt der Grünlandbiotoptypen der Bachauen anzeigen. Aktuell scheinen aber vielerorts<br />
Brachestadien zuzunehmen und ein Verschwinden von Pflanzen- und Tierarten zu begün-