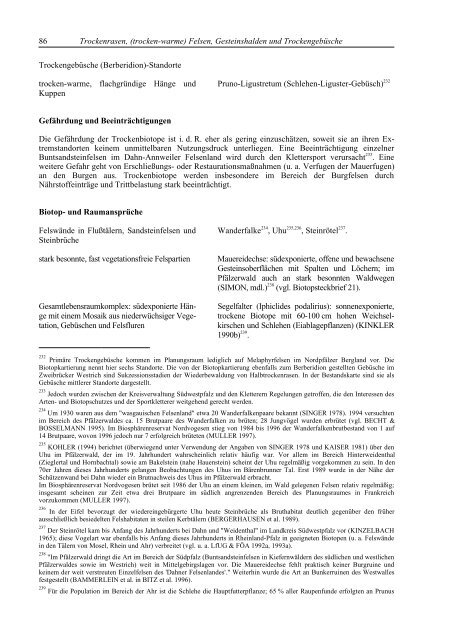Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
86 Trockenrasen, (trocken-warme) Felsen, Gesteinshalden und Trockengebüsche<br />
Trockengebüsche (Berberidion)-Standorte<br />
trocken-warme, flachgründige Hänge und<br />
Kuppen<br />
Gefährdung und Beeinträchtigungen<br />
Pruno-Ligustretum (Schlehen-Liguster-Gebüsch) 232<br />
Die Gefährdung der Trockenbiotope ist i. d. R. eher als gering einzuschätzen, soweit sie an ihren Extremstandorten<br />
keinem unmittelbaren Nutzungsdruck unterliegen. Eine Beeinträchtigung einzelner<br />
Buntsandsteinfelsen im Dahn-Annweiler Felsenland wird durch den Klettersport verursacht 233 . Eine<br />
weitere Gefahr geht von Erschließungs- oder Restaurationsmaßnahmen (u. a. Verfugen der Mauerfugen)<br />
an den Burgen aus. Trockenbiotope werden insbesondere im <strong>Bereich</strong> der Burgfelsen durch<br />
Nährstoffeinträge und Trittbelastung stark beeinträchtigt.<br />
Biotop- und Raumansprüche<br />
Felswände in Flußtälern, Sandsteinfelsen und<br />
Steinbrüche<br />
Wanderfalke 234 , Uhu 235,236 , Steinrötel 237 .<br />
stark besonnte, fast vegetationsfreie Felspartien Mauereidechse: südexponierte, offene und bewachsene<br />
Gesteinsoberflächen mit Spalten und Löchern; im<br />
Pfälzerwald auch an stark besonnten Waldwegen<br />
(SIMON, mdl.) 238 (vgl. Biotopsteckbrief 21).<br />
Gesamtlebensraumkomplex: südexponierte Hänge<br />
mit einem Mosaik aus niederwüchsiger Vegetation,<br />
Gebüschen und Felsfluren<br />
Segelfalter (Iphiclides podalirius): sonnenexponierte,<br />
trockene Biotope mit 60-100 cm hohen Weichselkirschen<br />
und Schlehen (Eiablagepflanzen) (KINKLER<br />
1990b) 239 .<br />
232<br />
Primäre Trockengebüsche kommen im <strong>Planung</strong>sraum lediglich auf Melaphyrfelsen im Nordpfälzer Bergland vor. Die<br />
Biotopkartierung nennt hier sechs Standorte. Die von der Biotopkartierung ebenfalls zum Berberidion gestellten Gebüsche im<br />
Zweibrücker Westrich sind Sukzessionsstadien der Wiederbewaldung von Halbtrockenrasen. In der Bestandskarte sind sie als<br />
Gebüsche mittlerer Standorte dargestellt.<br />
233<br />
Jedoch wurden zwischen der Kreisverwaltung <strong>Südwestpfalz</strong> und den Kletterern Regelungen getroffen, die den Interessen des<br />
Arten- und Biotopschutzes und der Sportkletterer weitgehend gerecht werden.<br />
234<br />
Um 1930 waren aus dem "wasgauischen Felsenland" etwa 20 Wanderfalkenpaare bekannt (SINGER 1978). 1994 versuchten<br />
im <strong>Bereich</strong> des Pfälzerwaldes ca. 15 Brutpaare des Wanderfalken zu brüten; 28 Jungvögel wurden erbrütet (vgl. BECHT &<br />
BOSSELMANN 1995). Im Biosphärenreservat Nordvogesen stieg von 1984 bis 1996 der Wanderfalkenbrutbestand von 1 auf<br />
14 Brutpaare, wovon 1996 jedoch nur 7 erfolgreich brüteten (MULLER 1997).<br />
235<br />
KOHLER (1994) berichtet (überwiegend unter Verwendung der Angaben von SINGER 1978 und KAISER 1981) über den<br />
Uhu im Pfälzerwald, der im 19. Jahrhundert wahrscheinlich relativ häufig war. Vor allem im <strong>Bereich</strong> Hinterweidenthal<br />
(Zieglertal und Hornbachtal) sowie am Bakelstein (nahe Hauenstein) scheint der Uhu regelmäßig vorgekommen zu sein. In den<br />
70er Jahren dieses Jahrhunderts gelangen Beobachtungen des Uhus im Bärenbrunner Tal. Erst 1989 wurde in der Nähe der<br />
Schützenwand bei Dahn wieder ein Brutnachweis des Uhus im Pfälzerwald erbracht.<br />
Im Biosphärenreservat Nordvogesen brütet seit 1986 der Uhu an einem kleinen, im Wald gelegenen Felsen relativ regelmäßig;<br />
insgesamt scheinen zur Zeit etwa drei Brutpaare im südlich angrenzenden <strong>Bereich</strong> des <strong>Planung</strong>sraumes in Frankreich<br />
vorzukommen (MULLER 1997).<br />
236<br />
In der Eifel bevorzugt der wiedereingebürgerte Uhu heute Steinbrüche als Bruthabitat deutlich gegenüber den früher<br />
ausschließlich besiedelten Felshabitaten in steilen Kerbtälern (BERGERHAUSEN et al. 1989).<br />
237<br />
Der Steinrötel kam bis Anfang des Jahrhunderts bei Dahn und "Weidenthal" im <strong>Landkreis</strong> <strong>Südwestpfalz</strong> vor (KINZELBACH<br />
1965); diese Vogelart war ebenfalls bis Anfang dieses Jahrhunderts in Rheinland-Pfalz in geeigneten Biotopen (u. a. Felswände<br />
in den Tälern von Mosel, Rhein und Ahr) verbreitet (vgl. u. a. LfUG & FÖA 1992a, 1993a).<br />
238<br />
"Im Pfälzerwald dringt die Art im <strong>Bereich</strong> der Südpfalz (Buntsandsteinfelsen in Kiefernwäldern des südlichen und westlichen<br />
Pfälzerwaldes sowie im Westrich) weit in Mittelgebirgslagen vor. Die Mauereidechse fehlt praktisch keiner Burgruine und<br />
keinem der weit verstreuten Einzelfelsen des 'Dahner Felsenlandes'." Weiterhin wurde die Art an Bunkerruinen des Westwalles<br />
festgestellt (BAMMERLEIN et al. in BITZ et al. 1996).<br />
239<br />
Für die Population im <strong>Bereich</strong> der Ahr ist die Schlehe die Hauptfutterpflanze; 65 % aller Raupenfunde erfolgten an Prunus