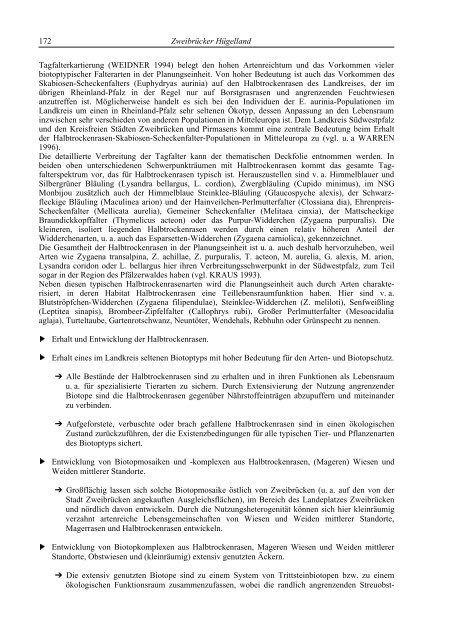Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
172 Zweibrücker Hügelland<br />
Tagfalterkartierung (WEIDNER 1994) belegt den hohen Artenreichtum und das Vorkommen vieler<br />
biotoptypischer Falterarten in der <strong>Planung</strong>seinheit. Von hoher Bedeutung ist auch das Vorkommen des<br />
Skabiosen-Scheckenfalters (Euphydryas aurinia) auf den Halbtrockenrasen des <strong>Landkreis</strong>es, der im<br />
übrigen Rheinland-Pfalz in der Regel nur auf Borstgrasrasen und angrenzenden Feuchtwiesen<br />
anzutreffen ist. Möglicherweise handelt es sich bei den Individuen der E. aurinia-Populationen im<br />
<strong>Landkreis</strong> um einen in Rheinland-Pfalz sehr seltenen Ökotyp, dessen Anpassung an den Lebensraum<br />
inzwischen sehr verschieden von anderen Populationen in Mitteleuropa ist. Dem <strong>Landkreis</strong> <strong>Südwestpfalz</strong><br />
und den Kreisfreien Städten Zweibrücken und Pirmasens kommt eine zentrale Bedeutung beim Erhalt<br />
der Halbtrockenrasen-Skabiosen-Scheckenfalter-Populationen in Mitteleuropa zu (vgl. u. a WARREN<br />
1996).<br />
Die detaillierte Verbreitung der Tagfalter kann der thematischen Deckfolie entnommen werden. In<br />
beiden oben unterschiedenen Schwerpunkträumen mit Halbtrockenrasen kommt das gesamte Tagfalterspektrum<br />
vor, das für Halbtrockenrasen typisch ist. Herauszustellen sind v. a. Himmelblauer und<br />
Silbergrüner Bläuling (Lysandra bellargus, L. cordion), Zwergbläuling (Cupido minimus), im NSG<br />
Monbijou zusätzlich auch der Himmelblaue Steinklee-Bläuling (Glaucospyche alexis), der Schwarzfleckige<br />
Bläuling (Maculinea arion) und der Hainveilchen-Perlmutterfalter (Clossiana dia), Ehrenpreis-<br />
Scheckenfalter (Mellicata aurelia), Gemeiner Scheckenfalter (Melitaea cinxia), der Mattscheckige<br />
Braundickkopffalter (Thymelicus acteon) oder das Purpur-Widderchen (Zygaena purpuralis). Die<br />
kleineren, isoliert liegenden Halbtrockenrasen werden durch einen relativ höheren Anteil der<br />
Widderchenarten, u. a. auch das Esparsetten-Widderchen (Zygaena carniolica), gekennzeichnet.<br />
Die Gesamtheit der Halbtrockenrasen in der <strong>Planung</strong>seinheit ist u. a. auch deshalb hervorzuheben, weil<br />
Arten wie Zygaena transalpina, Z. achillae, Z. purpuralis, T. acteon, M. aurelia, G. alexis, M. arion,<br />
Lysandra coridon oder L. bellargus hier ihren Verbreitungsschwerpunkt in der <strong>Südwestpfalz</strong>, zum Teil<br />
sogar in der Region des Pfälzerwaldes haben (vgl. KRAUS 1993).<br />
Neben diesen typischen Halbtrockenrasenarten wird die <strong>Planung</strong>seinheit auch durch Arten charakterisiert,<br />
in deren Habitat Halbtrockenrasen eine Teillebensraumfunktion haben. Hier sind v. a.<br />
Blutströpfchen-Widderchen (Zygaena filipendulae), Steinklee-Widderchen (Z. meliloti), Senfweißling<br />
(Leptitea sinapis), Brombeer-Zipfelfalter (Callophrys rubi), Großer Perlmutterfalter (Mesoacidalia<br />
aglaja), Turteltaube, Gartenrotschwanz, Neuntöter, Wendehals, Rebhuhn oder Grünspecht zu nennen.<br />
� Erhalt und Entwicklung der Halbtrockenrasen.<br />
� Erhalt eines im <strong>Landkreis</strong> seltenen Biotoptyps mit hoher Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
➔ Alle Bestände der Halbtrockenrasen sind zu erhalten und in ihren Funktionen als Lebensraum<br />
u. a. für spezialisierte Tierarten zu sichern. Durch Extensivierung der Nutzung angrenzender<br />
Biotope sind die Halbtrockenrasen gegenüber Nährstoffeinträgen abzupuffern und miteinander<br />
zu verbinden.<br />
➔ Aufgeforstete, verbuschte oder brach gefallene Halbtrockenrasen sind in einen ökologischen<br />
Zustand zurückzuführen, der die Existenzbedingungen für alle typischen Tier- und Pflanzenarten<br />
des Biotoptyps sichert.<br />
� Entwicklung von Biotopmosaiken und -komplexen aus Halbtrockenrasen, (Mageren) Wiesen und<br />
Weiden mittlerer Standorte.<br />
➔ Großflächig lassen sich solche Biotopmosaike östlich von Zweibrücken (u. a. auf den von der<br />
Stadt Zweibrücken angekauften Ausgleichsflächen), im <strong>Bereich</strong> des Landeplatzes Zweibrücken<br />
und nördlich davon entwickeln. Durch die Nutzungsheterogenität können sich hier kleinräumig<br />
verzahnt artenreiche Lebensgemeinschaften von Wiesen und Weiden mittlerer Standorte,<br />
Magerrasen und Halbtrockenrasen entwickeln.<br />
� Entwicklung von Biotopkomplexen aus Halbtrockenrasen, Mageren Wiesen und Weiden mittlerer<br />
Standorte, Obstwiesen und (kleinräumig) extensiv genutzten Äckern.<br />
➔ Die extensiv genutzten Biotope sind zu einem System von Trittsteinbiotopen bzw. zu einem<br />
ökologischen Funktionsraum zusammenzufassen, wobei die randlich angrenzenden Streuobst-