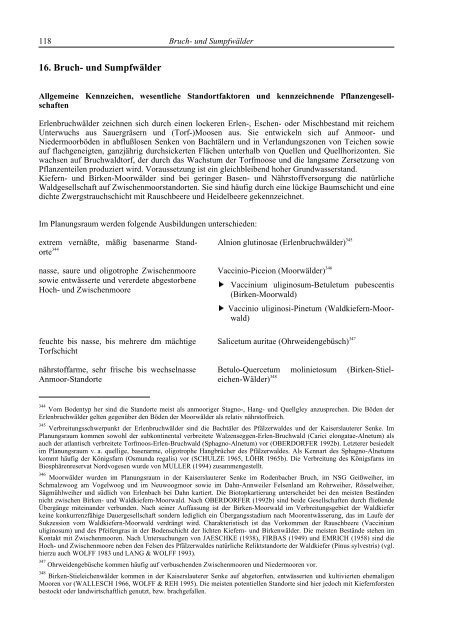Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
118 Bruch- und Sumpfwälder<br />
16. Bruch- und Sumpfwälder<br />
Allgemeine Kennzeichen, wesentliche Standortfaktoren und kennzeichnende Pflanzengesellschaften<br />
Erlenbruchwälder zeichnen sich durch einen lockeren Erlen-, Eschen- oder Mischbestand mit reichem<br />
Unterwuchs aus Sauergräsern und (Torf-)Moosen aus. Sie entwickeln sich auf Anmoor- und<br />
Niedermoorböden in abflußlosen Senken von Bachtälern und in Verlandungszonen von Teichen sowie<br />
auf flachgeneigten, ganzjährig durchsickerten Flächen unterhalb von Quellen und Quellhorizonten. Sie<br />
wachsen auf Bruchwaldtorf, der durch das Wachstum der Torfmoose und die langsame Zersetzung von<br />
Pflanzenteilen produziert wird. Voraussetzung ist ein gleichbleibend hoher Grundwasserstand.<br />
Kiefern- und Birken-Moorwälder sind bei geringer Basen- und Nährstoffversorgung die natürliche<br />
Waldgesellschaft auf Zwischenmoorstandorten. Sie sind häufig durch eine lückige Baumschicht und eine<br />
dichte Zwergstrauchschicht mit Rauschbeere und Heidelbeere gekennzeichnet.<br />
Im <strong>Planung</strong>sraum werden folgende Ausbildungen unterschieden:<br />
extrem vernäßte, mäßig basenarme Standorte<br />
344<br />
nasse, saure und oligotrophe Zwischenmoore<br />
sowie entwässerte und vererdete abgestorbene<br />
Hoch- und Zwischenmoore<br />
feuchte bis nasse, bis mehrere dm mächtige<br />
Torfschicht<br />
nährstoffarme, sehr frische bis wechselnasse<br />
Anmoor-Standorte<br />
Alnion glutinosae (Erlenbruchwälder) 345<br />
Vaccinio-Piceion (Moorwälder) 346<br />
� Vaccinium uliginosum-Betuletum pubescentis<br />
(Birken-Moorwald)<br />
� Vaccinio uliginosi-Pinetum (Waldkiefern-Moorwald)<br />
Salicetum auritae (Ohrweidengebüsch) 347<br />
Betulo-Quercetum molinietosum (Birken-Stieleichen-Wälder)<br />
348<br />
344<br />
Vom Bodentyp her sind die Standorte meist als anmooriger Stagno-, Hang- und Quellgley anzusprechen. Die Böden der<br />
Erlenbruchwälder gelten gegenüber den Böden der Moorwälder als relativ nährstoffreich.<br />
345<br />
Verbreitungsschwerpunkt der Erlenbruchwälder sind die Bachtäler des Pfälzerwaldes und der Kaiserslauterer Senke. Im<br />
<strong>Planung</strong>sraum kommen sowohl der subkontinental verbreitete Walzenseggen-Erlen-Bruchwald (Carici elongatae-Alnetum) als<br />
auch der atlantisch verbreitete Torfmoos-Erlen-Bruchwald (Sphagno-Alnetum) vor (OBERDORFER 1992b). Letzterer besiedelt<br />
im <strong>Planung</strong>sraum v. a. quellige, basenarme, oligotrophe Hangbrücher des Pfälzerwaldes. Als Kennart des Sphagno-Alnetums<br />
kommt häufig der Königsfarn (Osmunda regalis) vor (SCHULZE 1965, LÖHR 1965b). Die Verbreitung des Königsfarns im<br />
Biosphärenreservat Nordvogesen wurde von MULLER (1994) zusammengestellt.<br />
346<br />
Moorwälder wurden im <strong>Planung</strong>sraum in der Kaiserslauterer Senke im Rodenbacher Bruch, im NSG Geißweiher, im<br />
Schmalzwoog am Vogelwoog und im Neuwoogmoor sowie im Dahn-Annweiler Felsenland am Rohrweiher, Rösselweiher,<br />
Sägmühlweiher und südlich von Erlenbach bei Dahn kartiert. Die Biotopkartierung unterscheidet bei den meisten Beständen<br />
nicht zwischen Birken- und Waldkiefern-Moorwald. Nach OBERDORFER (1992b) sind beide Gesellschaften durch fließende<br />
Übergänge miteinander verbunden. Nach seiner Auffassung ist der Birken-Moorwald im Verbreitungsgebiet der Waldkiefer<br />
keine konkurrenzfähige Dauergesellschaft sondern lediglich ein Übergangsstadium nach Moorentwässerung, das im Laufe der<br />
Sukzession vom Waldkiefern-Moorwald verdrängt wird. Charakteristisch ist das Vorkommen der Rauschbeere (Vaccinium<br />
uliginosum) und des Pfeifengras in der Bodenschicht der lichten Kiefern- und Birkenwälder. Die meisten Bestände stehen im<br />
Kontakt mit Zwischenmooren. Nach Untersuchungen von JAESCHKE (1938), FIRBAS (1949) und EMRICH (1958) sind die<br />
Hoch- und Zwischenmoore neben den Felsen des Pfälzerwaldes natürliche Reliktstandorte der Waldkiefer (Pinus sylvestris) (vgl.<br />
hierzu auch WOLFF 1983 und LANG & WOLFF 1993).<br />
347<br />
Ohrweidengebüsche kommen häufig auf verbuschenden Zwischenmooren und Niedermooren vor.<br />
348<br />
Birken-Stieleichenwälder kommen in der Kaiserslauterer Senke auf abgetorften, entwässerten und kultivierten ehemaligen<br />
Mooren vor (WALLESCH 1966, WOLFF & REH 1995). Die meisten potentiellen Standorte sind hier jedoch mit Kiefernforsten<br />
bestockt oder landwirtschaftlich genutzt, bzw. brachgefallen.