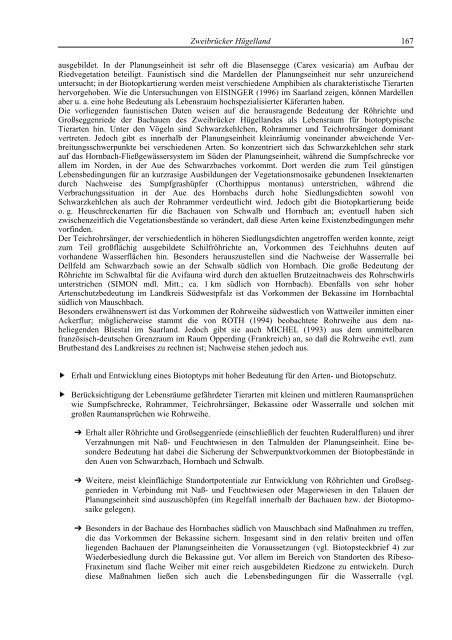Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Zweibrücker Hügelland 167<br />
ausgebildet. In der <strong>Planung</strong>seinheit ist sehr oft die Blasensegge (Carex vesicaria) am Aufbau der<br />
Riedvegetation beteiligt. Faunistisch sind die Mardellen der <strong>Planung</strong>seinheit nur sehr unzureichend<br />
untersucht; in der Biotopkartierung werden meist verschiedene Amphibien als charakteristische Tierarten<br />
hervorgehoben. Wie die Untersuchungen von EISINGER (1996) im Saarland zeigen, können Mardellen<br />
aber u. a. eine hohe Bedeutung als Lebensraum hochspezialisierter Käferarten haben.<br />
Die vorliegenden faunistischen Daten weisen auf die herausragende Bedeutung der Röhrichte und<br />
Großseggenriede der Bachauen des Zweibrücker Hügellandes als Lebensraum für biotoptypische<br />
Tierarten hin. Unter den Vögeln sind Schwarzkehlchen, Rohrammer und Teichrohrsänger dominant<br />
vertreten. Jedoch gibt es innerhalb der <strong>Planung</strong>seinheit kleinräumig voneinander abweichende Verbreitungsschwerpunkte<br />
bei verschiedenen Arten. So konzentriert sich das Schwarzkehlchen sehr stark<br />
auf das Hornbach-Fließgewässersystem im Süden der <strong>Planung</strong>seinheit, während die Sumpfschrecke vor<br />
allem im Norden, in der Aue des Schwarzbaches vorkommt. Dort werden die zum Teil günstigen<br />
Lebensbedingungen für an kurzrasige Ausbildungen der Vegetationsmosaike gebundenen Insektenarten<br />
durch Nachweise des Sumpfgrashüpfer (Chorthippus montanus) unterstrichen, während die<br />
Verbrachungssituation in der Aue des Hornbachs durch hohe Siedlungsdichten sowohl von<br />
Schwarzkehlchen als auch der Rohrammer verdeutlicht wird. Jedoch gibt die Biotopkartierung beide<br />
o. g. Heuschreckenarten für die Bachauen von Schwalb und Hornbach an; eventuell haben sich<br />
zwischenzeitlich die Vegetationsbestände so verändert, daß diese Arten keine Existenzbedingungen mehr<br />
vorfinden.<br />
Der Teichrohrsänger, der verschiedentlich in höheren Siedlungsdichten angetroffen werden konnte, zeigt<br />
zum Teil großflächig ausgebildete Schilfröhrichte an, Vorkommen des Teichhuhns deuten auf<br />
vorhandene Wasserflächen hin. Besonders herauszustellen sind die Nachweise der Wasserralle bei<br />
Dellfeld am Schwarzbach sowie an der Schwalb südlich von Hornbach. Die große Bedeutung der<br />
Röhrichte im Schwalbtal für die Avifauna wird durch den aktuellen Brutzeitnachweis des Rohrschwirls<br />
unterstrichen (SIMON mdl. Mitt.; ca. 1 km südlich von Hornbach). Ebenfalls von sehr hoher<br />
Artenschutzbedeutung im <strong>Landkreis</strong> <strong>Südwestpfalz</strong> ist das Vorkommen der Bekassine im Hornbachtal<br />
südlich von Mauschbach.<br />
Besonders erwähnenswert ist das Vorkommen der Rohrweihe südwestlich von Wattweiler inmitten einer<br />
Ackerflur; möglicherweise stammt die von ROTH (1994) beobachtete Rohrweihe aus dem naheliegenden<br />
Bliestal im Saarland. Jedoch gibt sie auch MICHEL (1993) aus dem unmittelbaren<br />
französisch-deutschen Grenzraum im Raum Opperding (Frankreich) an, so daß die Rohrweihe evtl. zum<br />
Brutbestand des <strong>Landkreis</strong>es zu rechnen ist; Nachweise stehen jedoch aus.<br />
� Erhalt und Entwicklung eines Biotoptyps mit hoher Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
� Berücksichtigung der Lebensräume gefährdeter Tierarten mit kleinen und mittleren Raumansprüchen<br />
wie Sumpfschrecke, Rohrammer, Teichrohrsänger, Bekassine oder Wasserralle und solchen mit<br />
großen Raumansprüchen wie Rohrweihe.<br />
➔ Erhalt aller Röhrichte und Großseggenriede (einschließlich der feuchten Ruderalfluren) und ihrer<br />
Verzahnungen mit Naß- und Feuchtwiesen in den Talmulden der <strong>Planung</strong>seinheit. Eine besondere<br />
Bedeutung hat dabei die Sicherung der Schwerpunktvorkommen der Biotopbestände in<br />
den Auen von Schwarzbach, Hornbach und Schwalb.<br />
➔ Weitere, meist kleinflächige Standortpotentiale zur Entwicklung von Röhrichten und Großseggenrieden<br />
in Verbindung mit Naß- und Feuchtwiesen oder Magerwiesen in den Talauen der<br />
<strong>Planung</strong>seinheit sind auszuschöpfen (im Regelfall innerhalb der Bachauen bzw. der Biotopmosaike<br />
gelegen).<br />
➔ Besonders in der Bachaue des Hornbaches südlich von Mauschbach sind Maßnahmen zu treffen,<br />
die das Vorkommen der Bekassine sichern. Insgesamt sind in den relativ breiten und offen<br />
liegenden Bachauen der <strong>Planung</strong>seinheiten die Voraussetzungen (vgl. Biotopsteckbrief 4) zur<br />
Wiederbesiedlung durch die Bekassine gut. Vor allem im <strong>Bereich</strong> von Standorten des Ribeso-<br />
Fraxinetum sind flache Weiher mit einer reich ausgebildeten Riedzone zu entwickeln. Durch<br />
diese Maßnahmen ließen sich auch die Lebensbedingungen für die Wasserralle (vgl.