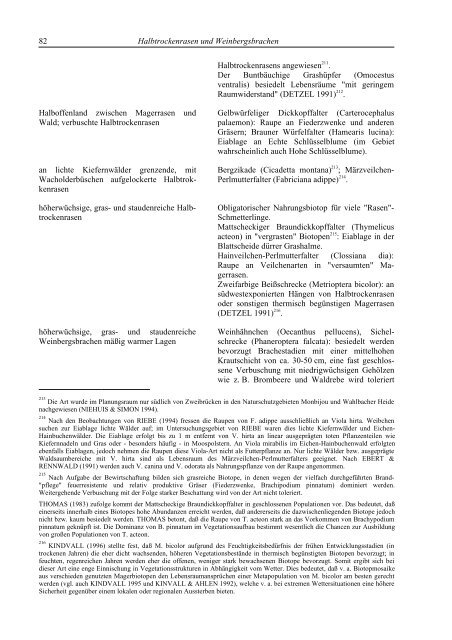Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
82 Halbtrockenrasen und Weinbergsbrachen<br />
Halboffenland zwischen Magerrasen und<br />
Wald; verbuschte Halbtrockenrasen<br />
an lichte Kiefernwälder grenzende, mit<br />
Wacholderbüschen aufgelockerte Halbtrokkenrasen<br />
höherwüchsige, gras- und staudenreiche Halbtrockenrasen<br />
höherwüchsige, gras- und staudenreiche<br />
Weinbergsbrachen mäßig warmer Lagen<br />
Halbtrockenrasens angewiesen 211 .<br />
Der Buntbäuchige Grashüpfer (Omocestus<br />
ventralis) besiedelt Lebensräume "mit geringem<br />
Raumwiderstand" (DETZEL 1991) 212 .<br />
Gelbwürfeliger Dickkopffalter (Carterocephalus<br />
palaemon): Raupe an Fiederzwenke und anderen<br />
Gräsern; Brauner Würfelfalter (Hamearis lucina):<br />
Eiablage an Echte Schlüsselblume (im Gebiet<br />
wahrscheinlich auch Hohe Schlüsselblume).<br />
Bergzikade (Cicadetta montana) 213 ; Märzveilchen-<br />
Perlmutterfalter (Fabriciana adippe) 214 .<br />
Obligatorischer Nahrungsbiotop für viele "Rasen"-<br />
Schmetterlinge.<br />
Mattscheckiger Braundickkopffalter (Thymelicus<br />
acteon) in "vergrasten" Biotopen 215 : Eiablage in der<br />
Blattscheide dürrer Grashalme.<br />
Hainveilchen-Perlmutterfalter (Clossiana dia):<br />
Raupe an Veilchenarten in "versaumten" Magerrasen.<br />
Zweifarbige Beißschrecke (Metrioptera bicolor): an<br />
südwestexponierten Hängen von Halbtrockenrasen<br />
oder sonstigen thermisch begünstigen Magerrasen<br />
(DETZEL 1991) 216 .<br />
Weinhähnchen (Oecanthus pellucens), Sichelschrecke<br />
(Phaneroptera falcata): besiedelt werden<br />
bevorzugt Brachestadien mit einer mittelhohen<br />
Krautschicht von ca. 30-50 cm, eine fast geschlossene<br />
Verbuschung mit niedrigwüchsigen Gehölzen<br />
wie z. B. Brombeere und Waldrebe wird toleriert<br />
213<br />
Die Art wurde im <strong>Planung</strong>sraum nur südlich von Zweibrücken in den Naturschutzgebieten Monbijou und Wahlbacher Heide<br />
nachgewiesen (NIEHUIS & SIMON 1994).<br />
214<br />
Nach den Beobachtungen von RIEBE (1994) fressen die Raupen von F. adippe ausschließlich an Viola hirta. Weibchen<br />
suchen zur Eiablage lichte Wälder auf; im Untersuchungsgebiet von RIEBE waren dies lichte Kiefernwälder und Eichen-<br />
Hainbuchenwälder. Die Eiablage erfolgt bis zu 1 m entfernt von V. hirta an linear ausgeprägten toten Pflanzenteilen wie<br />
Kiefernnadeln und Gras oder - besonders häufig - in Moospolstern. An Viola mirabilis im Eichen-Hainbuchenwald erfolgten<br />
ebenfalls Eiablagen, jedoch nehmen die Raupen diese Viola-Art nicht als Futterpflanze an. Nur lichte Wälder bzw. ausgeprägte<br />
Waldsaumbereiche mit V. hirta sind als Lebensraum des Märzveilchen-Perlmutterfalters geeignet. Nach EBERT &<br />
RENNWALD (1991) werden auch V. canina und V. odorata als Nahrungspflanze von der Raupe angenommen.<br />
215<br />
Nach Aufgabe der Bewirtschaftung bilden sich grasreiche Biotope, in denen wegen der vielfach durchgeführten Brand-<br />
"pflege" feuerresistente und relativ produktive Gräser (Fiederzwenke, Brachipodium pinnatum) dominiert werden.<br />
Weitergehende Verbuschung mit der Folge starker Beschattung wird von der Art nicht toleriert.<br />
THOMAS (1983) zufolge kommt der Mattscheckige Braundickkopffalter in geschlossenen Populationen vor. Das bedeutet, daß<br />
einerseits innerhalb eines Biotopes hohe Abundanzen erreicht werden, daß andererseits die dazwischenliegenden Biotope jedoch<br />
nicht bzw. kaum besiedelt werden. THOMAS betont, daß die Raupe von T. acteon stark an das Vorkommen von Brachypodium<br />
pinnatum geknüpft ist. Die Dominanz von B. pinnatum im Vegetationsaufbau bestimmt wesentlich die Chancen zur Ausbildung<br />
von großen Populationen von T. acteon.<br />
216<br />
KINDVALL (1996) stellte fest, daß M. bicolor aufgrund des Feuchtigkeitsbedürfnis der frühen Entwicklungsstadien (in<br />
trockenen Jahren) die eher dicht wachsenden, höheren Vegetationsbestände in thermisch begünstigten Biotopen bevorzugt; in<br />
feuchten, regenreichen Jahren werden eher die offenen, weniger stark bewachsenen Biotope bevorzugt. Somit ergibt sich bei<br />
dieser Art eine enge Einnischung in Vegetationsstrukturen in Abhängigkeit vom Wetter. Dies bedeutet, daß v. a. Biotopmosaike<br />
aus verschieden genutzten Magerbiotopen den Lebensraumansprüchen einer Metapopulation von M. bicolor am besten gerecht<br />
werden (vgl. auch KINDVALL 1995 und KINVALL & AHLEN 1992), welche v. a. bei extremen Wettersituationen eine höhere<br />
Sicherheit gegenüber einem lokalen oder regionalen Aussterben bieten.