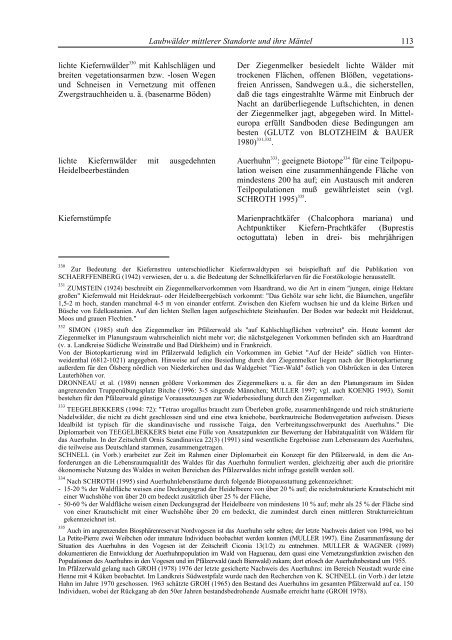Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
lichte Kiefernwälder 330 mit Kahlschlägen und<br />
breiten vegetationsarmen bzw. -losen Wegen<br />
und Schneisen in Vernetzung mit offenen<br />
Zwergstrauchheiden u. ä. (basenarme Böden)<br />
lichte Kiefernwälder mit ausgedehnten<br />
Heidelbeerbeständen<br />
Laubwälder mittlerer Standorte und ihre Mäntel 113<br />
Der Ziegenmelker besiedelt lichte Wälder mit<br />
trockenen Flächen, offenen Blößen, vegetationsfreien<br />
Anrissen, Sandwegen u.ä., die sicherstellen,<br />
daß die tags eingestrahlte Wärme mit Einbruch der<br />
Nacht an darüberliegende Luftschichten, in denen<br />
der Ziegenmelker jagt, abgegeben wird. In Mitteleuropa<br />
erfüllt Sandboden diese Bedingungen am<br />
besten (GLUTZ von BLOTZHEIM & BAUER<br />
1980) 331,332 .<br />
Auerhuhn 333 : geeignete Biotope 334 für eine Teilpopulation<br />
weisen eine zusammenhängende Fläche von<br />
mindestens 200 ha auf; ein Austausch mit anderen<br />
Teilpopulationen muß gewährleistet sein (vgl.<br />
SCHROTH 1995) 335 .<br />
Kiefernstümpfe Marienprachtkäfer (Chalcophora mariana) und<br />
Achtpunktiker Kiefern-Prachtkäfer (Buprestis<br />
octoguttata) leben in drei- bis mehrjährigen<br />
330<br />
Zur Bedeutung der Kiefernstreu unterschiedlicher Kiefernwaldtypen sei beispielhaft auf die Publikation von<br />
SCHAERFFENBERG (1942) verwiesen, der u. a. die Bedeutung der Schnellkäferlarven für die Forstökologie herausstellt.<br />
331<br />
ZUMSTEIN (1924) beschreibt ein Ziegenmelkervorkommen vom Haardtrand, wo die Art in einem "jungen, einige Hektare<br />
großen" Kiefernwald mit Heidekraut- oder Heidelbeergebüsch vorkommt: "Das Gehölz war sehr licht, die Bäumchen, ungefähr<br />
1,5-2 m hoch, standen manchmal 4-5 m von einander entfernt. Zwischen den Kiefern wuchsen hie und da kleine Birken und<br />
Büsche von Edelkastanien. Auf den lichten Stellen lagen aufgeschichtete Steinhaufen. Der Boden war bedeckt mit Heidekraut,<br />
Moos und grauen Flechten."<br />
332<br />
SIMON (1985) stuft den Ziegenmelker im Pfälzerwald als "auf Kahlschlagflächen verbreitet" ein. Heute kommt der<br />
Ziegenmelker im <strong>Planung</strong>sraum wahrscheinlich nicht mehr vor; die nächstgelegenen Vorkommen befinden sich am Haardtrand<br />
(v. a. <strong>Landkreis</strong>e Südliche Weinstraße und Bad Dürkheim) und in Frankreich.<br />
Von der Biotopkartierung wird im Pfälzerwald lediglich ein Vorkommen im Gebiet "Auf der Heide" südlich von Hinterweidenthal<br />
(6812-1021) angegeben. Hinweise auf eine Besiedlung durch den Ziegenmelker liegen nach der Biotopkartierung<br />
außerdem für den Ölsberg nördlich von Niederkirchen und das Waldgebiet "Tier-Wald" östlich von Olsbrücken in den Unteren<br />
Lauterhöhen vor.<br />
DRONNEAU et al. (1989) nennen größere Vorkommen des Ziegenmelkers u. a. für den an den <strong>Planung</strong>sraum im Süden<br />
angrenzenden Truppenübungsplatz Bitche (1996: 3-5 singende Männchen; MULLER 1997; vgl. auch KOENIG 1993). Somit<br />
bestehen für den Pfälzerwald günstige Voraussetzungen zur Wiederbesiedlung durch den Ziegenmelker.<br />
333<br />
TEEGELBEKKERS (1994: 72): "Tetrao urogallus braucht zum Überleben große, zusammenhängende und reich strukturierte<br />
Nadelwälder, die nicht zu dicht geschlossen sind und eine etwa kniehohe, beerkrautreiche Bodenvegetation aufweisen. Dieses<br />
Idealbild ist typisch für die skandinavische und russische Taiga, den Verbreitungsschwerpunkt des Auerhuhns." Die<br />
Diplomarbeit von TEEGELBEKKERS bietet eine Fülle von Ansatzpunkten zur Bewertung der Habitatqualität von Wäldern für<br />
das Auerhuhn. In der Zeitschrift Ornis Scandinavica 22(3) (1991) sind wesentliche Ergebnisse zum Lebensraum des Auerhuhns,<br />
die teilweise aus Deutschland stammen, zusammengetragen.<br />
SCHNELL (in Vorb.) erarbeitet zur Zeit im Rahmen einer Diplomarbeit ein Konzept für den Pfälzerwald, in dem die Anforderungen<br />
an die Lebensraumqualität des Waldes für das Auerhuhn formuliert werden, gleichzeitig aber auch die prioritäre<br />
ökonomische Nutzung des Waldes in weiten <strong>Bereich</strong>en des Pfälzerwaldes nicht infrage gestellt werden soll.<br />
334<br />
Nach SCHROTH (1995) sind Auerhuhnlebensräume durch folgende Biotopausstattung gekennzeichnet:<br />
- 15-20 % der Waldfläche weisen eine Deckungsgrad der Heidelbeere von über 20 % auf; die reichstrukturierte Krautschicht mit<br />
einer Wuchshöhe von über 20 cm bedeckt zusätzlich über 25 % der Fläche,<br />
- 50-60 % der Waldfläche weisen einen Deckungsgrad der Heidelbeere von mindestens 10 % auf; mehr als 25 % der Fläche sind<br />
von einer Krautschicht mit einer Wuchshöhe über 20 cm bedeckt, die zumindest durch einen mittleren Strukturreichtum<br />
gekennzeichnet ist.<br />
335<br />
Auch im angrenzenden Biosphärenreservat Nordvogesen ist das Auerhuhn sehr selten; der letzte Nachweis datiert von 1994, wo bei<br />
La Petite-Pierre zwei Weibchen oder immature Individuen beobachtet werden konnten (MULLER 1997). Eine Zusammenfassung der<br />
Situation des Auerhuhns in den Vogesen ist der Zeitschrift Ciconia 13(1/2) zu entnehmen. MULLER & WAGNER (1989)<br />
dokumentieren die Entwicklung der Auerhuhnpopulation im Wald von Haguenau, dem quasi eine Vernetzungsfunktion zwischen den<br />
Populationen des Auerhuhns in den Vogesen und im Pfälzerwald (auch Bienwald) zukam; dort erlosch der Auerhuhnbestand um 1955.<br />
Im Pfälzerwald gelang nach GROH (1978) 1976 der letzte gesicherte Nachweis des Auerhuhns: im <strong>Bereich</strong> Neustadt wurde eine<br />
Henne mit 4 Küken beobachtet. Im <strong>Landkreis</strong> <strong>Südwestpfalz</strong> wurde nach den Recherchen von K. SCHNELL (in Vorb.) der letzte<br />
Hahn im Jahre 1970 geschossen. 1963 schätzte GROH (1965) den Bestand des Auerhuhns im gesamten Pfälzerwald auf ca. 150<br />
Individuen, wobei der Rückgang ab den 50er Jahren bestandsbedrohende Ausmaße erreicht hatte (GROH 1978).