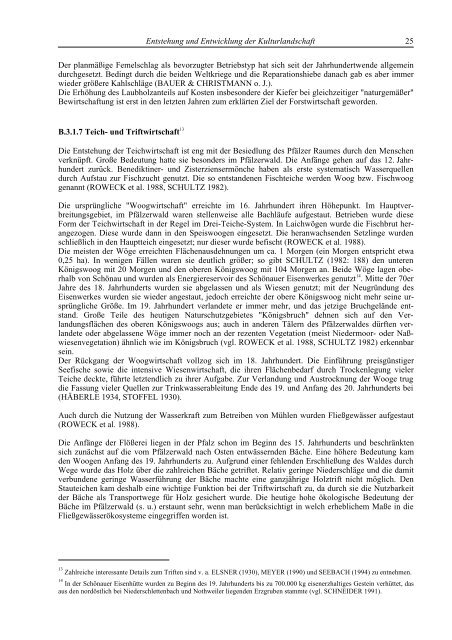Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Entstehung und Entwicklung der Kulturlandschaft 25<br />
Der planmäßige Femelschlag als bevorzugter Betriebstyp hat sich seit der Jahrhundertwende allgemein<br />
durchgesetzt. Bedingt durch die beiden Weltkriege und die Reparationshiebe danach gab es aber immer<br />
wieder größere Kahlschläge (BAUER & CHRISTMANN o. J.).<br />
Die Erhöhung des Laubholzanteils auf Kosten insbesondere der Kiefer bei gleichzeitiger "naturgemäßer"<br />
Bewirtschaftung ist erst in den letzten Jahren zum erklärten Ziel der Forstwirtschaft geworden.<br />
B.3.1.7 Teich- und Triftwirtschaft 13<br />
Die Entstehung der Teichwirtschaft ist eng mit der Besiedlung des Pfälzer Raumes durch den Menschen<br />
verknüpft. Große Bedeutung hatte sie besonders im Pfälzerwald. Die Anfänge gehen auf das 12. Jahrhundert<br />
zurück. Benediktiner- und Zisterziensermönche haben als erste systematisch Wasserquellen<br />
durch Aufstau zur Fischzucht genutzt. Die so entstandenen Fischteiche werden Woog bzw. Fischwoog<br />
genannt (ROWECK et al. 1988, SCHULTZ 1982).<br />
Die ursprüngliche "Woogwirtschaft" erreichte im 16. Jahrhundert ihren Höhepunkt. Im Hauptverbreitungsgebiet,<br />
im Pfälzerwald waren stellenweise alle Bachläufe aufgestaut. Betrieben wurde diese<br />
Form der Teichwirtschaft in der Regel im Drei-Teiche-System. In Laichwögen wurde die Fischbrut herangezogen.<br />
Diese wurde dann in den Speiswoogen eingesetzt. Die heranwachsenden Setzlinge wurden<br />
schließlich in den Hauptteich eingesetzt; nur dieser wurde befischt (ROWECK et al. 1988).<br />
Die meisten der Wöge erreichten Flächenausdehnungen um ca. 1 Morgen (ein Morgen entspricht etwa<br />
0,25 ha). In wenigen Fällen waren sie deutlich größer; so gibt SCHULTZ (1982: 188) den unteren<br />
Königswoog mit 20 Morgen und den oberen Königswoog mit 104 Morgen an. Beide Wöge lagen oberhalb<br />
von Schönau und wurden als Energiereservoir des Schönauer Eisenwerkes genutzt 14 . Mitte der 70er<br />
Jahre des 18. Jahrhunderts wurden sie abgelassen und als Wiesen genutzt; mit der Neugründung des<br />
Eisenwerkes wurden sie wieder angestaut, jedoch erreichte der obere Königswoog nicht mehr seine ursprüngliche<br />
Größe. Im 19. Jahrhundert verlandete er immer mehr, und das jetzige Bruchgelände entstand.<br />
Große Teile des heutigen Naturschutzgebietes "Königsbruch" dehnen sich auf den Verlandungsflächen<br />
des oberen Königswoogs aus; auch in anderen Tälern des Pfälzerwaldes dürften verlandete<br />
oder abgelassene Wöge immer noch an der rezenten Vegetation (meist Niedermoor- oder Naßwiesenvegetation)<br />
ähnlich wie im Königsbruch (vgl. ROWECK et al. 1988, SCHULTZ 1982) erkennbar<br />
sein.<br />
Der Rückgang der Woogwirtschaft vollzog sich im 18. Jahrhundert. Die Einführung preisgünstiger<br />
Seefische sowie die intensive Wiesenwirtschaft, die ihren Flächenbedarf durch Trockenlegung vieler<br />
Teiche deckte, führte letztendlich zu ihrer Aufgabe. Zur Verlandung und Austrocknung der Wooge trug<br />
die Fassung vieler Quellen zur Trinkwasserableitung Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts bei<br />
(HÄBERLE 1934, STOFFEL 1930).<br />
Auch durch die Nutzung der Wasserkraft zum Betreiben von Mühlen wurden Fließgewässer aufgestaut<br />
(ROWECK et al. 1988).<br />
Die Anfänge der Flößerei liegen in der Pfalz schon im Beginn des 15. Jahrhunderts und beschränkten<br />
sich zunächst auf die vom Pfälzerwald nach Osten entwässernden Bäche. Eine höhere Bedeutung kam<br />
den Woogen Anfang des 19. Jahrhunderts zu. Aufgrund einer fehlenden Erschließung des Waldes durch<br />
Wege wurde das Holz über die zahlreichen Bäche getriftet. Relativ geringe Niederschläge und die damit<br />
verbundene geringe Wasserführung der Bäche machte eine ganzjährige Holztrift nicht möglich. Den<br />
Stauteichen kam deshalb eine wichtige Funktion bei der Triftwirtschaft zu, da durch sie die Nutzbarkeit<br />
der Bäche als Transportwege für Holz gesichert wurde. Die heutige hohe ökologische Bedeutung der<br />
Bäche im Pfälzerwald (s. u.) erstaunt sehr, wenn man berücksichtigt in welch erheblichem Maße in die<br />
Fließgewässerökosysteme eingegriffen worden ist.<br />
13<br />
Zahlreiche interessante Details zum Triften sind v. a. ELSNER (1930), MEYER (1990) und SEEBACH (1994) zu entnehmen.<br />
14<br />
In der Schönauer Eisenhütte wurden zu Beginn des 19. Jahrhunderts bis zu 700.000 kg eisenerzhaltiges Gestein verhüttet, das<br />
aus den nordöstlich bei Niederschlettenbach und Nothweiler liegenden Erzgruben stammte (vgl. SCHNEIDER 1991).