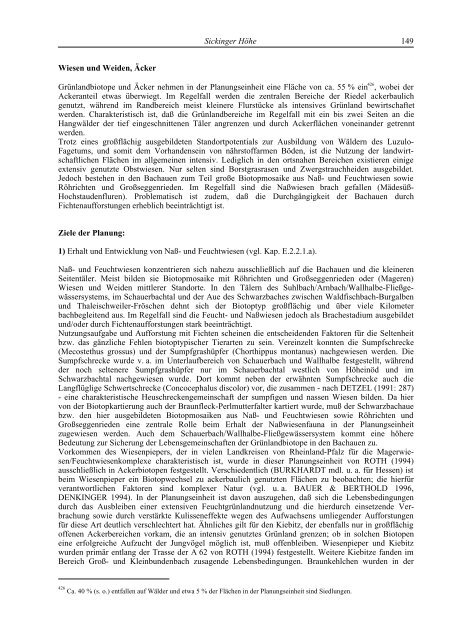Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Wiesen und Weiden, Äcker<br />
Sickinger Höhe 149<br />
Grünlandbiotope und Äcker nehmen in der <strong>Planung</strong>seinheit eine Fläche von ca. 55 % ein 426 , wobei der<br />
Ackeranteil etwas überwiegt. Im Regelfall werden die zentralen <strong>Bereich</strong>e der Riedel ackerbaulich<br />
genutzt, während im Randbereich meist kleinere Flurstücke als intensives Grünland bewirtschaftet<br />
werden. Charakteristisch ist, daß die Grünlandbereiche im Regelfall mit ein bis zwei Seiten an die<br />
Hangwälder der tief eingeschnittenen Täler angrenzen und durch Ackerflächen voneinander getrennt<br />
werden.<br />
Trotz eines großflächig ausgebildeten Standortpotentials zur Ausbildung von Wäldern des Luzulo-<br />
Fagetums, und somit dem Vorhandensein von nährstoffarmen Böden, ist die Nutzung der landwirtschaftlichen<br />
Flächen im allgemeinen intensiv. Lediglich in den ortsnahen <strong>Bereich</strong>en existieren einige<br />
extensiv genutzte Obstwiesen. Nur selten sind Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden ausgebildet.<br />
Jedoch bestehen in den Bachauen zum Teil große Biotopmosaike aus Naß- und Feuchtwiesen sowie<br />
Röhrichten und Großseggenrieden. Im Regelfall sind die Naßwiesen brach gefallen (Mädesüß-<br />
Hochstaudenfluren). Problematisch ist zudem, daß die Durchgängigkeit der Bachauen durch<br />
Fichtenaufforstungen erheblich beeinträchtigt ist.<br />
Ziele der <strong>Planung</strong>:<br />
1) Erhalt und Entwicklung von Naß- und Feuchtwiesen (vgl. Kap. E.2.2.1.a).<br />
Naß- und Feuchtwiesen konzentrieren sich nahezu ausschließlich auf die Bachauen und die kleineren<br />
Seitentäler. Meist bilden sie Biotopmosaike mit Röhrichten und Großseggenrieden oder (Mageren)<br />
Wiesen und Weiden mittlerer Standorte. In den Tälern des Suhlbach/Arnbach/Wallhalbe-Fließgewässersystems,<br />
im Schauerbachtal und der Aue des Schwarzbaches zwischen Waldfischbach-Burgalben<br />
und Thaleischweiler-Fröschen dehnt sich der Biotoptyp großflächig und über viele Kilometer<br />
bachbegleitend aus. Im Regelfall sind die Feucht- und Naßwiesen jedoch als Brachestadium ausgebildet<br />
und/oder durch Fichtenaufforstungen stark beeinträchtigt.<br />
Nutzungsaufgabe und Aufforstung mit Fichten scheinen die entscheidenden Faktoren für die Seltenheit<br />
bzw. das gänzliche Fehlen biotoptypischer Tierarten zu sein. Vereinzelt konnten die Sumpfschrecke<br />
(Mecostethus grossus) und der Sumpfgrashüpfer (Chorthippus montanus) nachgewiesen werden. Die<br />
Sumpfschrecke wurde v. a. im Unterlaufbereich von Schauerbach und Wallhalbe festgestellt, während<br />
der noch seltenere Sumpfgrashüpfer nur im Schauerbachtal westlich von Höheinöd und im<br />
Schwarzbachtal nachgewiesen wurde. Dort kommt neben der erwähnten Sumpfschrecke auch die<br />
Langflüglige Schwertschrecke (Concocephalus discolor) vor, die zusammen - nach DETZEL (1991: 287)<br />
- eine charakteristische Heuschreckengemeinschaft der sumpfigen und nassen Wiesen bilden. Da hier<br />
von der Biotopkartierung auch der Braunfleck-Perlmutterfalter kartiert wurde, muß der Schwarzbachaue<br />
bzw. den hier ausgebildeten Biotopmosaiken aus Naß- und Feuchtwiesen sowie Röhrichten und<br />
Großseggenrieden eine zentrale Rolle beim Erhalt der Naßwiesenfauna in der <strong>Planung</strong>seinheit<br />
zugewiesen werden. Auch dem Schauerbach/Wallhalbe-Fließgewässersystem kommt eine höhere<br />
Bedeutung zur Sicherung der Lebensgemeinschaften der Grünlandbiotope in den Bachauen zu.<br />
Vorkommen des Wiesenpiepers, der in vielen <strong>Landkreis</strong>en von Rheinland-Pfalz für die Magerwiesen/Feuchtwiesenkomplexe<br />
charakteristisch ist, wurde in dieser <strong>Planung</strong>seinheit von ROTH (1994)<br />
ausschließlich in Ackerbiotopen festgestellt. Verschiedentlich (BURKHARDT mdl. u. a. für Hessen) ist<br />
beim Wiesenpieper ein Biotopwechsel zu ackerbaulich genutzten Flächen zu beobachten; die hierfür<br />
verantwortlichen Faktoren sind komplexer Natur (vgl. u. a. BAUER & BERTHOLD 1996,<br />
DENKINGER 1994). In der <strong>Planung</strong>seinheit ist davon auszugehen, daß sich die Lebensbedingungen<br />
durch das Ausbleiben einer extensiven Feuchtgrünlandnutzung und die hierdurch einsetzende Verbrachung<br />
sowie durch verstärkte Kulisseneffekte wegen des Aufwachsens umliegender Aufforstungen<br />
für diese Art deutlich verschlechtert hat. Ähnliches gilt für den Kiebitz, der ebenfalls nur in großflächig<br />
offenen Ackerbereichen vorkam, die an intensiv genutztes Grünland grenzen; ob in solchen Biotopen<br />
eine erfolgreiche Aufzucht der Jungvögel möglich ist, muß offenbleiben. Wiesenpieper und Kiebitz<br />
wurden primär entlang der Trasse der A 62 von ROTH (1994) festgestellt. Weitere Kiebitze fanden im<br />
<strong>Bereich</strong> Groß- und Kleinbundenbach zusagende Lebensbedingungen. Braunkehlchen wurden in der<br />
426 Ca. 40 % (s. o.) entfallen auf Wälder und etwa 5 % der Flächen in der <strong>Planung</strong>seinheit sind Siedlungen.