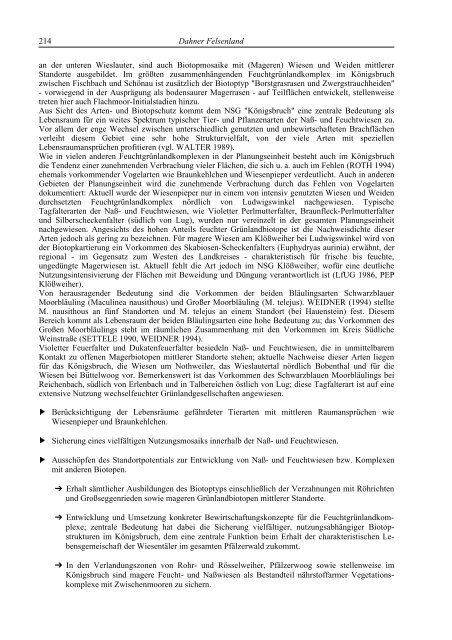Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
214 Dahner Felsenland<br />
an der unteren Wieslauter, sind auch Biotopmosaike mit (Mageren) Wiesen und Weiden mittlerer<br />
Standorte ausgebildet. Im größten zusammenhängenden Feuchtgrünlandkomplex im Königsbruch<br />
zwischen Fischbach und Schönau ist zusätzlich der Biotoptyp "Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden"<br />
- vorwiegend in der Ausprägung als bodensaurer Magerrasen - auf Teilflächen entwickelt, stellenweise<br />
treten hier auch Flachmoor-Initialstadien hinzu.<br />
Aus Sicht des Arten- und Biotopschutz kommt dem NSG "Königsbruch" eine zentrale Bedeutung als<br />
Lebensraum für ein weites Spektrum typischer Tier- und Pflanzenarten der Naß- und Feuchtwiesen zu.<br />
Vor allem der enge Wechsel zwischen unterschiedlich genutzten und unbewirtschafteten Brachflächen<br />
verleiht diesem Gebiet eine sehr hohe Strukturvielfalt, von der viele Arten mit speziellen<br />
Lebensraumansprüchen profitieren (vgl. WALTER 1989).<br />
Wie in vielen anderen Feuchtgrünlandkomplexen in der <strong>Planung</strong>seinheit besteht auch im Königsbruch<br />
die Tendenz einer zunehmenden Verbrachung vieler Flächen, die sich u. a. auch im Fehlen (ROTH 1994)<br />
ehemals vorkommender Vogelarten wie Braunkehlchen und Wiesenpieper verdeutlicht. Auch in anderen<br />
Gebieten der <strong>Planung</strong>seinheit wird die zunehmende Verbrachung durch das Fehlen von Vogelarten<br />
dokumentiert: Aktuell wurde der Wiesenpieper nur in einem von intensiv genutzten Wiesen und Weiden<br />
durchsetzten Feuchtgrünlandkomplex nördlich von Ludwigswinkel nachgewiesen. Typische<br />
Tagfalterarten der Naß- und Feuchtwiesen, wie Violetter Perlmutterfalter, Braunfleck-Perlmutterfalter<br />
und Silberscheckenfalter (südlich von Lug), wurden nur vereinzelt in der gesamten <strong>Planung</strong>seinheit<br />
nachgewiesen. Angesichts des hohen Anteils feuchter Grünlandbiotope ist die Nachweisdichte dieser<br />
Arten jedoch als gering zu bezeichnen. Für magere Wiesen am Klößweiher bei Ludwigswinkel wird von<br />
der Biotopkartierung ein Vorkommen des Skabiosen-Scheckenfalters (Euphydryas aurinia) erwähnt, der<br />
regional - im Gegensatz zum Westen des <strong>Landkreis</strong>es - charakteristisch für frische bis feuchte,<br />
ungedüngte Magerwiesen ist. Aktuell fehlt die Art jedoch im NSG Klößweiher, wofür eine deutliche<br />
Nutzungsintensivierung der Flächen mit Beweidung und Düngung verantwortlich ist (LfUG 1986, PEP<br />
Klößweiher).<br />
Von herausragender Bedeutung sind die Vorkommen der beiden Bläulingsarten Schwarzblauer<br />
Moorbläuling (Maculinea nausithous) und Großer Moorbläuling (M. telejus). WEIDNER (1994) stellte<br />
M. nausithous an fünf Standorten und M. telejus an einem Standort (bei Hauenstein) fest. Diesem<br />
<strong>Bereich</strong> kommt als Lebensraum der beiden Bläulingsarten eine hohe Bedeutung zu; das Vorkommen des<br />
Großen Moorbläulings steht im räumlichen Zusammenhang mit den Vorkommen im Kreis Südliche<br />
Weinstraße (SETTELE 1990, WEIDNER 1994).<br />
Violetter Feuerfalter und Dukatenfeuerfalter besiedeln Naß- und Feuchtwiesen, die in unmittelbarem<br />
Kontakt zu offenen Magerbiotopen mittlerer Standorte stehen; aktuelle Nachweise dieser Arten liegen<br />
für das Königsbruch, die Wiesen um Nothweiler, das Wieslautertal nördlich Bobenthal und für die<br />
Wiesen bei Büttelwoog vor. Bemerkenswert ist das Vorkommen des Schwarzblauen Moorbläulings bei<br />
Reichenbach, südlich von Erlenbach und in Talbereichen östlich von Lug; diese Tagfalterart ist auf eine<br />
extensive Nutzung wechselfeuchter Grünlandgesellschaften angewiesen.<br />
� Berücksichtigung der Lebensräume gefährdeter Tierarten mit mittleren Raumansprüchen wie<br />
Wiesenpieper und Braunkehlchen.<br />
� Sicherung eines vielfältigen Nutzungsmosaiks innerhalb der Naß- und Feuchtwiesen.<br />
� Ausschöpfen des Standortpotentials zur Entwicklung von Naß- und Feuchtwiesen bzw. Komplexen<br />
mit anderen Biotopen.<br />
➔ Erhalt sämtlicher Ausbildungen des Biotoptyps einschließlich der Verzahnungen mit Röhrichten<br />
und Großseggenrieden sowie mageren Grünlandbiotopen mittlerer Standorte.<br />
➔ Entwicklung und Umsetzung konkreter Bewirtschaftungskonzepte für die Feuchtgrünlandkomplexe;<br />
zentrale Bedeutung hat dabei die Sicherung vielfältiger, nutzungsabhängiger Biotopstrukturen<br />
im Königsbruch, dem eine zentrale Funktion beim Erhalt der charakteristischen Lebensgemeischaft<br />
der Wiesentäler im gesamten Pfälzerwald zukommt.<br />
➔ In den Verlandungszonen von Rohr- und Rösselweiher, Pfälzerwoog sowie stellenweise im<br />
Königsbruch sind magere Feucht- und Naßwiesen als Bestandteil nährstoffarmer Vegetationskomplexe<br />
mit Zwischenmooren zu sichern.