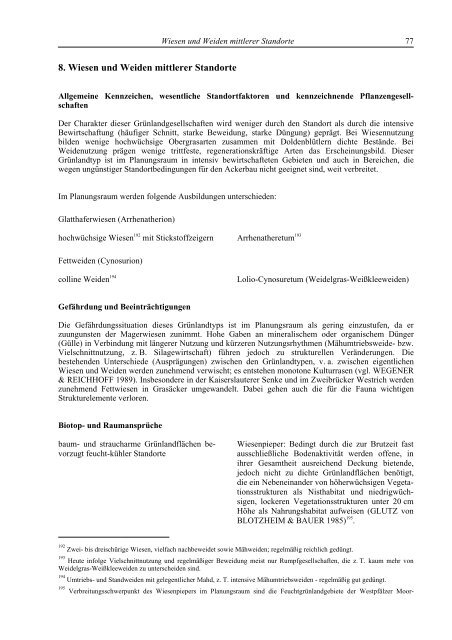Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
8. Wiesen und Weiden mittlerer Standorte<br />
Wiesen und Weiden mittlerer Standorte 77<br />
Allgemeine Kennzeichen, wesentliche Standortfaktoren und kennzeichnende Pflanzengesellschaften<br />
Der Charakter dieser Grünlandgesellschaften wird weniger durch den Standort als durch die intensive<br />
Bewirtschaftung (häufiger Schnitt, starke Beweidung, starke Düngung) geprägt. Bei Wiesennutzung<br />
bilden wenige hochwüchsige Obergrasarten zusammen mit Doldenblütlern dichte Bestände. Bei<br />
Weidenutzung prägen wenige trittfeste, regenerationskräftige Arten das Erscheinungsbild. Dieser<br />
Grünlandtyp ist im <strong>Planung</strong>sraum in intensiv bewirtschafteten Gebieten und auch in <strong>Bereich</strong>en, die<br />
wegen ungünstiger Standortbedingungen für den Ackerbau nicht geeignet sind, weit verbreitet.<br />
Im <strong>Planung</strong>sraum werden folgende Ausbildungen unterschieden:<br />
Glatthaferwiesen (Arrhenatherion)<br />
hochwüchsige Wiesen 192 mit Stickstoffzeigern Arrhenatheretum 193<br />
Fettweiden (Cynosurion)<br />
colline Weiden 194<br />
Gefährdung und Beeinträchtigungen<br />
Lolio-Cynosuretum (Weidelgras-Weißkleeweiden)<br />
Die Gefährdungssituation dieses Grünlandtyps ist im <strong>Planung</strong>sraum als gering einzustufen, da er<br />
zuungunsten der Magerwiesen zunimmt. Hohe Gaben an mineralischem oder organischem Dünger<br />
(Gülle) in Verbindung mit längerer Nutzung und kürzeren Nutzungsrhythmen (Mähumtriebsweide- bzw.<br />
Vielschnittnutzung, z. B. Silagewirtschaft) führen jedoch zu strukturellen Veränderungen. Die<br />
bestehenden Unterschiede (Ausprägungen) zwischen den Grünlandtypen, v. a. zwischen eigentlichen<br />
Wiesen und Weiden werden zunehmend verwischt; es entstehen monotone Kulturrasen (vgl. WEGENER<br />
& REICHHOFF 1989). Insbesondere in der Kaiserslauterer Senke und im Zweibrücker Westrich werden<br />
zunehmend Fettwiesen in Grasäcker umgewandelt. Dabei gehen auch die für die Fauna wichtigen<br />
Strukturelemente verloren.<br />
Biotop- und Raumansprüche<br />
baum- und straucharme Grünlandflächen bevorzugt<br />
feucht-kühler Standorte<br />
Wiesenpieper: Bedingt durch die zur Brutzeit fast<br />
ausschließliche Bodenaktivität werden offene, in<br />
ihrer Gesamtheit ausreichend Deckung bietende,<br />
jedoch nicht zu dichte Grünlandflächen benötigt,<br />
die ein Nebeneinander von höherwüchsigen Vegetationsstrukturen<br />
als Nisthabitat und niedrigwüchsigen,<br />
lockeren Vegetationsstrukturen unter 20 cm<br />
Höhe als Nahrungshabitat aufweisen (GLUTZ von<br />
BLOTZHEIM & BAUER 1985) 195 .<br />
192<br />
Zwei- bis dreischürige Wiesen, vielfach nachbeweidet sowie Mähweiden; regelmäßig reichlich gedüngt.<br />
193<br />
Heute infolge Vielschnittnutzung und regelmäßiger Beweidung meist nur Rumpfgesellschaften, die z. T. kaum mehr von<br />
Weidelgras-Weißkleeweiden zu unterscheiden sind.<br />
194<br />
Umtriebs- und Standweiden mit gelegentlicher Mahd, z. T. intensive Mähumtriebsweiden - regelmäßig gut gedüngt.<br />
195<br />
Verbreitungsschwerpunkt des Wiesenpiepers im <strong>Planung</strong>sraum sind die Feuchtgrünlandgebiete der Westpfälzer Moor-