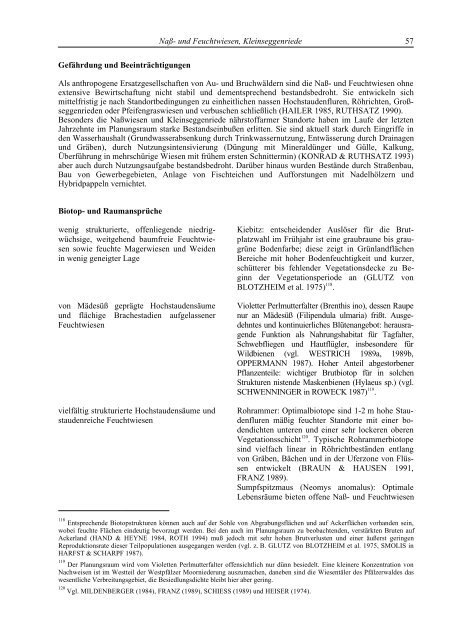Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Gefährdung und Beeinträchtigungen<br />
Naß- und Feuchtwiesen, Kleinseggenriede 57<br />
Als anthropogene Ersatzgesellschaften von Au- und Bruchwäldern sind die Naß- und Feuchtwiesen ohne<br />
extensive Bewirtschaftung nicht stabil und dementsprechend bestandsbedroht. Sie entwickeln sich<br />
mittelfristig je nach Standortbedingungen zu einheitlichen nassen Hochstaudenfluren, Röhrichten, Großseggenrieden<br />
oder Pfeifengraswiesen und verbuschen schließlich (HAILER 1985, RUTHSATZ 1990).<br />
Besonders die Naßwiesen und Kleinseggenriede nährstoffarmer Standorte haben im Laufe der letzten<br />
Jahrzehnte im <strong>Planung</strong>sraum starke Bestandseinbußen erlitten. Sie sind aktuell stark durch Eingriffe in<br />
den Wasserhaushalt (Grundwasserabsenkung durch Trinkwassernutzung, Entwässerung durch Drainagen<br />
und Gräben), durch Nutzungsintensivierung (Düngung mit Mineraldünger und Gülle, Kalkung,<br />
Überführung in mehrschürige Wiesen mit frühem ersten Schnittermin) (KONRAD & RUTHSATZ 1993)<br />
aber auch durch Nutzungsaufgabe bestandsbedroht. Darüber hinaus wurden Bestände durch Straßenbau,<br />
Bau von Gewerbegebieten, Anlage von Fischteichen und Aufforstungen mit Nadelhölzern und<br />
Hybridpappeln vernichtet.<br />
Biotop- und Raumansprüche<br />
wenig strukturierte, offenliegende niedrigwüchsige,<br />
weitgehend baumfreie Feuchtwiesen<br />
sowie feuchte Magerwiesen und Weiden<br />
in wenig geneigter Lage<br />
von Mädesüß geprägte Hochstaudensäume<br />
und flächige Brachestadien aufgelassener<br />
Feuchtwiesen<br />
vielfältig strukturierte Hochstaudensäume und<br />
staudenreiche Feuchtwiesen<br />
Kiebitz: entscheidender Auslöser für die Brutplatzwahl<br />
im Frühjahr ist eine graubraune bis graugrüne<br />
Bodenfarbe; diese zeigt in Grünlandflächen<br />
<strong>Bereich</strong>e mit hoher Bodenfeuchtigkeit und kurzer,<br />
schütterer bis fehlender Vegetationsdecke zu Beginn<br />
der Vegetationsperiode an (GLUTZ von<br />
BLOTZHEIM et al. 1975) 118 .<br />
Violetter Perlmutterfalter (Brenthis ino), dessen Raupe<br />
nur an Mädesüß (Filipendula ulmaria) frißt. Ausgedehntes<br />
und kontinuierliches Blütenangebot: herausragende<br />
Funktion als Nahrungshabitat für Tagfalter,<br />
Schwebfliegen und Hautflügler, insbesondere für<br />
Wildbienen (vgl. WESTRICH 1989a, 1989b,<br />
OPPERMANN 1987). Hoher Anteil abgestorbener<br />
Pflanzenteile: wichtiger Brutbiotop für in solchen<br />
Strukturen nistende Maskenbienen (Hylaeus sp.) (vgl.<br />
SCHWENNINGER in ROWECK 1987) 119 .<br />
Rohrammer: Optimalbiotope sind 1-2 m hohe Staudenfluren<br />
mäßig feuchter Standorte mit einer bodendichten<br />
unteren und einer sehr lockeren oberen<br />
Vegetationsschicht 120 . Typische Rohrammerbiotope<br />
sind vielfach linear in Röhrichtbeständen entlang<br />
von Gräben, Bächen und in der Uferzone von Flüssen<br />
entwickelt (BRAUN & HAUSEN 1991,<br />
FRANZ 1989).<br />
Sumpfspitzmaus (Neomys anomalus): Optimale<br />
Lebensräume bieten offene Naß- und Feuchtwiesen<br />
118<br />
Entsprechende Biotopstrukturen können auch auf der Sohle von Abgrabungsflächen und auf Ackerflächen vorhanden sein,<br />
wobei feuchte Flächen eindeutig bevorzugt werden. Bei den auch im <strong>Planung</strong>sraum zu beobachtenden, verstärkten Bruten auf<br />
Ackerland (HAND & HEYNE 1984, ROTH 1994) muß jedoch mit sehr hohen Brutverlusten und einer äußerst geringen<br />
Reproduktionsrate dieser Teilpopulationen ausgegangen werden (vgl. z. B. GLUTZ von BLOTZHEIM et al. 1975, SMOLIS in<br />
HARFST & SCHARPF 1987).<br />
119<br />
Der <strong>Planung</strong>sraum wird vom Violetten Perlmutterfalter offensichtlich nur dünn besiedelt. Eine kleinere Konzentration von<br />
Nachweisen ist im Westteil der Westpfälzer Moorniederung auszumachen, daneben sind die Wiesentäler des Pfälzerwaldes das<br />
wesentliche Verbreitungsgebiet, die Besiedlungsdichte bleibt hier aber gering.<br />
120<br />
Vgl. MILDENBERGER (1984), FRANZ (1989), SCHIESS (1989) und HEISER (1974).