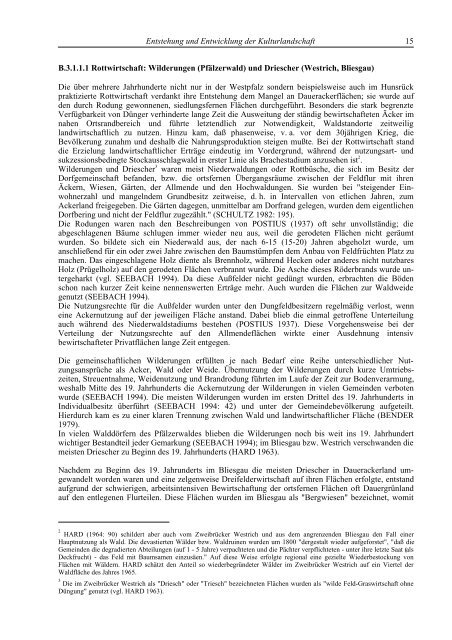Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Entstehung und Entwicklung der Kulturlandschaft 15<br />
B.3.1.1.1 Rottwirtschaft: Wilderungen (Pfälzerwald) und Driescher (Westrich, Bliesgau)<br />
Die über mehrere Jahrhunderte nicht nur in der Westpfalz sondern beispielsweise auch im Hunsrück<br />
praktizierte Rottwirtschaft verdankt ihre Entstehung dem Mangel an Dauerackerflächen; sie wurde auf<br />
den durch Rodung gewonnenen, siedlungsfernen Flächen durchgeführt. Besonders die stark begrenzte<br />
Verfügbarkeit von Dünger verhinderte lange Zeit die Ausweitung der ständig bewirtschafteten Äcker im<br />
nahen Ortsrandbereich und führte letztendlich zur Notwendigkeit, Waldstandorte zeitweilig<br />
landwirtschaftlich zu nutzen. Hinzu kam, daß phasenweise, v. a. vor dem 30jährigen Krieg, die<br />
Bevölkerung zunahm und deshalb die Nahrungsproduktion steigen mußte. Bei der Rottwirtschaft stand<br />
die Erzielung landwirtschaftlicher Erträge eindeutig im Vordergrund, während der nutzungsart- und<br />
sukzessionsbedingte Stockausschlagwald in erster Linie als Brachestadium anzusehen ist 2 .<br />
Wilderungen und Driescher 3 waren meist Niederwaldungen oder Rottbüsche, die sich im Besitz der<br />
Dorfgemeinschaft befanden, bzw. die ortsfernen Übergangsräume zwischen der Feldflur mit ihren<br />
Äckern, Wiesen, Gärten, der Allmende und den Hochwaldungen. Sie wurden bei "steigender Einwohnerzahl<br />
und mangelndem Grundbesitz zeitweise, d. h. in Intervallen von etlichen Jahren, zum<br />
Ackerland freigegeben. Die Gärten dagegen, unmittelbar am Dorfrand gelegen, wurden dem eigentlichen<br />
Dorfbering und nicht der Feldflur zugezählt." (SCHULTZ 1982: 195).<br />
Die Rodungen waren nach den Beschreibungen von POSTIUS (1937) oft sehr unvollständig; die<br />
abgeschlagenen Bäume schlugen immer wieder neu aus, weil die gerodeten Flächen nicht geräumt<br />
wurden. So bildete sich ein Niederwald aus, der nach 6-15 (15-20) Jahren abgeholzt wurde, um<br />
anschließend für ein oder zwei Jahre zwischen den Baumstümpfen dem Anbau von Feldfrüchten Platz zu<br />
machen. Das eingeschlagene Holz diente als Brennholz, während Hecken oder anderes nicht nutzbares<br />
Holz (Prügelholz) auf den gerodeten Flächen verbrannt wurde. Die Asche dieses Röderbrands wurde untergeharkt<br />
(vgl. SEEBACH 1994). Da diese Außfelder nicht gedüngt wurden, erbrachten die Böden<br />
schon nach kurzer Zeit keine nennenswerten Erträge mehr. Auch wurden die Flächen zur Waldweide<br />
genutzt (SEEBACH 1994).<br />
Die Nutzungsrechte für die Außfelder wurden unter den Dungfeldbesitzern regelmäßig verlost, wenn<br />
eine Ackernutzung auf der jeweiligen Fläche anstand. Dabei blieb die einmal getroffene Unterteilung<br />
auch während des Niederwaldstadiums bestehen (POSTIUS 1937). Diese Vorgehensweise bei der<br />
Verteilung der Nutzungsrechte auf den Allmendeflächen wirkte einer Ausdehnung intensiv<br />
bewirtschafteter Privatflächen lange Zeit entgegen.<br />
Die gemeinschaftlichen Wilderungen erfüllten je nach Bedarf eine Reihe unterschiedlicher Nutzungsansprüche<br />
als Acker, Wald oder Weide. Übernutzung der Wilderungen durch kurze Umtriebszeiten,<br />
Streuentnahme, Weidenutzung und Brandrodung führten im Laufe der Zeit zur Bodenverarmung,<br />
weshalb Mitte des 19. Jahrhunderts die Ackernutzung der Wilderungen in vielen Gemeinden verboten<br />
wurde (SEEBACH 1994). Die meisten Wilderungen wurden im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts in<br />
Individualbesitz überführt (SEEBACH 1994: 42) und unter der Gemeindebevölkerung aufgeteilt.<br />
Hierdurch kam es zu einer klaren Trennung zwischen Wald und landwirtschaftlicher Fläche (BENDER<br />
1979).<br />
In vielen Walddörfern des Pfälzerwaldes blieben die Wilderungen noch bis weit ins 19. Jahrhundert<br />
wichtiger Bestandteil jeder Gemarkung (SEEBACH 1994); im Bliesgau bzw. Westrich verschwanden die<br />
meisten Driescher zu Beginn des 19. Jahrhunderts (HARD 1963).<br />
Nachdem zu Beginn des 19. Jahrunderts im Bliesgau die meisten Driescher in Dauerackerland umgewandelt<br />
worden waren und eine zelgenweise Dreifelderwirtschaft auf ihren Flächen erfolgte, entstand<br />
aufgrund der schwierigen, arbeitsintensiven Bewirtschaftung der ortsfernen Flächen oft Dauergrünland<br />
auf den entlegenen Flurteilen. Diese Flächen wurden im Bliesgau als "Bergwiesen" bezeichnet, womit<br />
2<br />
HARD (1964: 90) schildert aber auch vom Zweibrücker Westrich und aus dem angrenzenden Bliesgau den Fall einer<br />
Hauptnutzung als Wald. Die devastierten Wälder bzw. Waldruinen wurden um 1800 "dergestalt wieder aufgeforstet", "daß die<br />
Gemeinden die degradierten Abteilungen (auf 1 - 5 Jahre) verpachteten und die Pächter verpflichteten - unter ihre letzte Saat (als<br />
Deckfrucht) - das Feld mit Baumsamen einzusäen." Auf diese Weise erfolgte regional eine gezielte Wiederbestockung von<br />
Flächen mit Wäldern. HARD schätzt den Anteil so wiederbegründeter Wälder im Zweibrücker Westrich auf ein Viertel der<br />
Waldfläche des Jahres 1965.<br />
3<br />
Die im Zweibrücker Westrich als "Driesch" oder "Triesch" bezeichneten Flächen wurden als "wilde Feld-Graswirtschaft ohne<br />
Düngung" genutzt (vgl. HARD 1963).