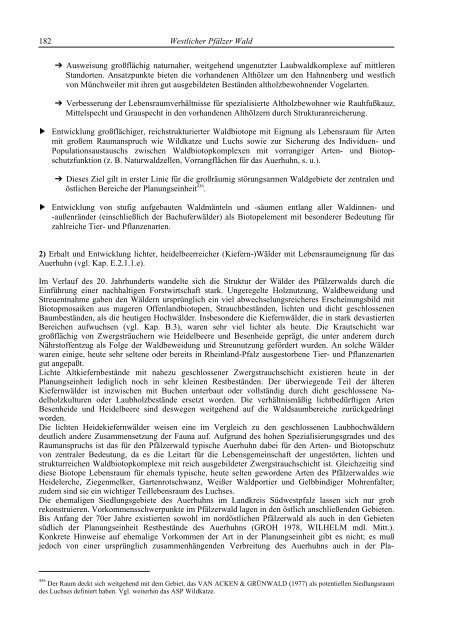Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
182 Westlicher Pfälzer Wald<br />
➔ Ausweisung großflächig naturnaher, weitgehend ungenutzter Laubwaldkomplexe auf mittleren<br />
Standorten. Ansatzpunkte bieten die vorhandenen Althölzer um den Hahnenberg und westlich<br />
von Münchweiler mit ihren gut ausgebildeten Beständen altholzbewohnender Vogelarten.<br />
➔ Verbesserung der Lebensraumverhältnisse für spezialisierte Altholzbewohner wie Rauhfußkauz,<br />
Mittelspecht und Grauspecht in den vorhandenen Althölzern durch Strukturanreicherung.<br />
� Entwicklung großflächiger, reichstrukturierter Waldbiotope mit Eignung als Lebensraum für Arten<br />
mit großem Raumanspruch wie Wildkatze und Luchs sowie zur Sicherung des Individuen- und<br />
Populationsaustauschs zwischen Waldbiotopkomplexen mit vorrangiger Arten- und Biotopschutzfunktion<br />
(z. B. Naturwaldzellen, Vorrangflächen für das Auerhuhn, s. u.).<br />
➔ Dieses Ziel gilt in erster Linie für die großräumig störungsarmen Waldgebiete der zentralen und<br />
östlichen <strong>Bereich</strong>e der <strong>Planung</strong>seinheit 436 .<br />
� Entwicklung von stufig aufgebauten Waldmänteln und -säumen entlang aller Waldinnen- und<br />
-außenränder (einschließlich der Bachuferwälder) als Biotopelement mit besonderer Bedeutung für<br />
zahlreiche Tier- und Pflanzenarten.<br />
2) Erhalt und Entwicklung lichter, heidelbeerreicher (Kiefern-)Wälder mit Lebensraumeignung für das<br />
Auerhuhn (vgl. Kap. E.2.1.1.e).<br />
Im Verlauf des 20. Jahrhunderts wandelte sich die Struktur der Wälder des Pfälzerwalds durch die<br />
Einführung einer nachhaltigen Forstwirtschaft stark. Ungeregelte Holznutzung, Waldbeweidung und<br />
Streuentnahme gaben den Wäldern ursprünglich ein viel abwechselungsreicheres Erscheinungsbild mit<br />
Biotopmosaiken aus mageren Offenlandbiotopen, Strauchbeständen, lichten und dicht geschlossenen<br />
Baumbeständen, als die heutigen Hochwälder. Insbesondere die Kiefernwälder, die in stark devastierten<br />
<strong>Bereich</strong>en aufwuchsen (vgl. Kap. B.3), waren sehr viel lichter als heute. Die Krautschicht war<br />
großflächig von Zwergsträuchern wie Heidelbeere und Besenheide geprägt, die unter anderem durch<br />
Nährstoffentzug als Folge der Waldbeweidung und Streunutzung gefördert wurden. An solche Wälder<br />
waren einige, heute sehr seltene oder bereits in Rheinland-Pfalz ausgestorbene Tier- und Pflanzenarten<br />
gut angepaßt.<br />
Lichte Altkiefernbestände mit nahezu geschlossener Zwergstrauchschicht existieren heute in der<br />
<strong>Planung</strong>seinheit lediglich noch in sehr kleinen Restbeständen. Der überwiegende Teil der älteren<br />
Kiefernwälder ist inzwischen mit Buchen unterbaut oder vollständig durch dicht geschlossene Nadelholzkulturen<br />
oder Laubholzbestände ersetzt worden. Die verhältnismäßig lichtbedürftigen Arten<br />
Besenheide und Heidelbeere sind deswegen weitgehend auf die Waldsaumbereiche zurückgedrängt<br />
worden.<br />
Die lichten Heidekiefernwälder weisen eine im Vergleich zu den geschlossenen Laubhochwäldern<br />
deutlich andere Zusammensetzung der Fauna auf. Aufgrund des hohen Spezialisierungsgrades und des<br />
Raumanspruchs ist das für den Pfälzerwald typische Auerhuhn dabei für den Arten- und Biotopschutz<br />
von zentraler Bedeutung, da es die Leitart für die Lebensgemeinschaft der ungestörten, lichten und<br />
strukturreichen Waldbiotopkomplexe mit reich ausgebildeter Zwergstrauchschicht ist. Gleichzeitig sind<br />
diese Biotope Lebensraum für ehemals typische, heute selten gewordene Arten des Pfälzerwaldes wie<br />
Heidelerche, Ziegenmelker, Gartenrotschwanz, Weißer Waldportier und Gelbbindiger Mohrenfalter;<br />
zudem sind sie ein wichtiger Teillebensraum des Luchses.<br />
Die ehemaligen Siedlungsgebiete des Auerhuhns im <strong>Landkreis</strong> <strong>Südwestpfalz</strong> lassen sich nur grob<br />
rekonstruieren. Vorkommensschwerpunkte im Pfälzerwald lagen in den östlich anschließenden Gebieten.<br />
Bis Anfang der 70er Jahre existierten sowohl im nordöstlichen Pfälzerwald als auch in den Gebieten<br />
südlich der <strong>Planung</strong>seinheit Restbestände des Auerhuhns (GROH 1978, WILHELM mdl. Mitt.).<br />
Konkrete Hinweise auf ehemalige Vorkommen der Art in der <strong>Planung</strong>seinheit gibt es nicht; es muß<br />
jedoch von einer ursprünglich zusammenhängenden Verbreitung des Auerhuhns auch in der Pla-<br />
436 Der Raum deckt sich weitgehend mit dem Gebiet, das VAN ACKEN & GRÜNWALD (1977) als potentiellen Siedlungsraum<br />
des Luchses definiert haben. Vgl. weiterhin das ASP Wildkatze.