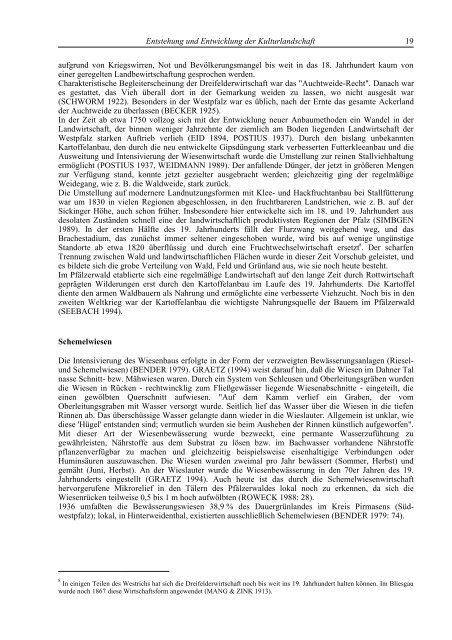Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Entstehung und Entwicklung der Kulturlandschaft 19<br />
aufgrund von Kriegswirren, Not und Bevölkerungsmangel bis weit in das 18. Jahrhundert kaum von<br />
einer geregelten Landbewirtschaftung gesprochen werden.<br />
Charakteristische Begleiterscheinung der Dreifelderwirtschaft war das "Auchtweide-Recht". Danach war<br />
es gestattet, das Vieh überall dort in der Gemarkung weiden zu lassen, wo nicht ausgesät war<br />
(SCHWORM 1922). Besonders in der Westpfalz war es üblich, nach der Ernte das gesamte Ackerland<br />
der Auchtweide zu überlassen (BECKER 1925).<br />
In der Zeit ab etwa 1750 vollzog sich mit der Entwicklung neuer Anbaumethoden ein Wandel in der<br />
Landwirtschaft, der binnen weniger Jahrzehnte der ziemlich am Boden liegenden Landwirtschaft der<br />
Westpfalz starken Auftrieb verlieh (EID 1894, POSTIUS 1937). Durch den bislang unbekannten<br />
Kartoffelanbau, den durch die neu entwickelte Gipsdüngung stark verbesserten Futterkleeanbau und die<br />
Ausweitung und Intensivierung der Wiesenwirtschaft wurde die Umstellung zur reinen Stallviehhaltung<br />
ermöglicht (POSTIUS 1937, WEIDMANN 1989). Der anfallende Dünger, der jetzt in größeren Mengen<br />
zur Verfügung stand, konnte jetzt gezielter ausgebracht werden; gleichzeitig ging der regelmäßige<br />
Weidegang, wie z. B. die Waldweide, stark zurück.<br />
Die Umstellung auf modernere Landnutzungsformen mit Klee- und Hackfruchtanbau bei Stallfütterung<br />
war um 1830 in vielen Regionen abgeschlossen, in den fruchtbareren Landstrichen, wie z. B. auf der<br />
Sickinger Höhe, auch schon früher. Insbesondere hier entwickelte sich im 18. und 19. Jahrhundert aus<br />
desolaten Zuständen schnell eine der landwirtschaftlich produktivsten Regionen der Pfalz (SIMBGEN<br />
1989). In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts fällt der Flurzwang weitgehend weg, und das<br />
Brachestadium, das zunächst immer seltener eingeschoben wurde, wird bis auf wenige ungünstige<br />
Standorte ab etwa 1820 überflüssig und durch eine Fruchtwechselwirtschaft ersetzt 8 . Der scharfen<br />
Trennung zwischen Wald und landwirtschaftlichen Flächen wurde in dieser Zeit Vorschub geleistet, und<br />
es bildete sich die grobe Verteilung von Wald, Feld und Grünland aus, wie sie noch heute besteht.<br />
Im Pfälzerwald etablierte sich eine regelmäßige Landwirtschaft auf den lange Zeit durch Rottwirtschaft<br />
geprägten Wilderungen erst durch den Kartoffelanbau im Laufe des 19. Jahrhunderts. Die Kartoffel<br />
diente den armen Waldbauern als Nahrung und ermöglichte eine verbesserte Viehzucht. Noch bis in den<br />
zweiten Weltkrieg war der Kartoffelanbau die wichtigste Nahrungsquelle der Bauern im Pfälzerwald<br />
(SEEBACH 1994).<br />
Schemelwiesen<br />
Die Intensivierung des Wiesenbaus erfolgte in der Form der verzweigten Bewässerungsanlagen (Rieselund<br />
Schemelwiesen) (BENDER 1979). GRAETZ (1994) weist darauf hin, daß die Wiesen im Dahner Tal<br />
nasse Schnitt- bzw. Mähwiesen waren. Durch ein System von Schleusen und Oberleitungsgräben wurden<br />
die Wiesen in Rücken - rechtwincklig zum Fließgewässer liegende Wiesenabschnitte - eingeteilt, die<br />
einen gewölbten Querschnitt aufwiesen. "Auf dem Kamm verlief ein Graben, der vom<br />
Oberleitungsgraben mit Wasser versorgt wurde. Seitlich lief das Wasser über die Wiesen in die tiefen<br />
Rinnen ab. Das überschüssige Wasser gelangte dann wieder in die Wieslauter. Allgemein ist unklar, wie<br />
diese 'Hügel' entstanden sind; vermutlich wurden sie beim Ausheben der Rinnen künstlich aufgeworfen".<br />
Mit dieser Art der Wiesenbewässerung wurde bezweckt, eine permante Wasserzuführung zu<br />
gewährleisten, Nährstoffe aus dem Substrat zu lösen bzw. im Bachwasser vorhandene Nährstoffe<br />
pflanzenverfügbar zu machen und gleichzeitig beispielsweise eisenhaltigige Verbindungen oder<br />
Huminsäuren auszuwaschen. Die Wiesen wurden zweimal pro Jahr bewässert (Sommer, Herbst) und<br />
gemäht (Juni, Herbst). An der Wieslauter wurde die Wiesenbewässerung in den 70er Jahren des 19.<br />
Jahrhunderts eingestellt (GRAETZ 1994). Auch heute ist das durch die Schemelwiesenwirtschaft<br />
hervorgerufene Mikrorelief in den Tälern des Pfälzerwaldes lokal noch zu erkennen, da sich die<br />
Wiesenrücken teilweise 0,5 bis 1 m hoch aufwölbten (ROWECK 1988: 28).<br />
1936 umfaßten die Bewässerungswiesen 38,9 % des Dauergrünlandes im Kreis Pirmasens (<strong>Südwestpfalz</strong>);<br />
lokal, in Hinterweidenthal, existierten ausschließlich Schemelwiesen (BENDER 1979: 74).<br />
8 In einigen Teilen des Westrichs hat sich die Dreifelderwirtschaft noch bis weit ins 19. Jahrhundert halten können. Im Bliesgau<br />
wurde noch 1867 diese Wirtschaftsform angewendet (MANG & ZINK 1913).