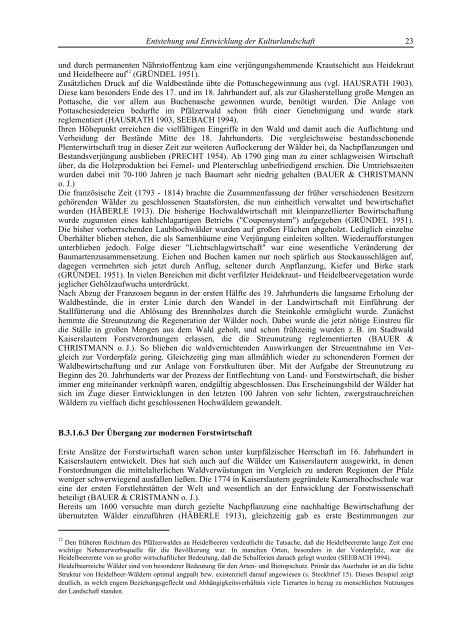Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Entstehung und Entwicklung der Kulturlandschaft 23<br />
und durch permanenten Nährstoffentzug kam eine verjüngungshemmende Krautschicht aus Heidekraut<br />
und Heidelbeere auf 12 (GRÜNDEL 1951).<br />
Zusätzlichen Druck auf die Waldbestände übte die Pottaschegewinnung aus (vgl. HAUSRATH 1903).<br />
Diese kam besonders Ende des 17. und im 18. Jahrhundert auf, als zur Glasherstellung große Mengen an<br />
Pottasche, die vor allem aus Buchenasche gewonnen wurde, benötigt wurden. Die Anlage von<br />
Pottaschesiedereien bedurfte im Pfälzerwald schon früh einer Genehmigung und wurde stark<br />
reglementiert (HAUSRATH 1903, SEEBACH 1994).<br />
Ihren Höhepunkt erreichen die vielfältigen Eingriffe in den Wald und damit auch die Auflichtung und<br />
Verheidung der Bestände Mitte des 18. Jahrhunderts. Die vergleichsweise bestandsschonende<br />
Plenterwirtschaft trug in dieser Zeit zur weiteren Auflockerung der Wälder bei, da Nachpflanzungen und<br />
Bestandsverjüngung ausblieben (PRECHT 1954). Ab 1790 ging man zu einer schlagweisen Wirtschaft<br />
über, da die Holzproduktion bei Femel- und Plenterschlag unbefriedigend erschien. Die Umtriebszeiten<br />
wurden dabei mit 70-100 Jahren je nach Baumart sehr niedrig gehalten (BAUER & CHRISTMANN<br />
o. J.)<br />
Die französische Zeit (1793 - 1814) brachte die Zusammenfassung der früher verschiedenen Besitzern<br />
gehörenden Wälder zu geschlossenen Staatsforsten, die nun einheitlich verwaltet und bewirtschaftet<br />
wurden (HÄBERLE 1913). Die bisherige Hochwaldwirtschaft mit kleinparzellierter Bewirtschaftung<br />
wurde zugunsten eines kahlschlagartigen Betriebs ("Coupensystem") aufgegeben (GRÜNDEL 1951).<br />
Die bisher vorherrschenden Laubhochwälder wurden auf großen Flächen abgeholzt. Lediglich einzelne<br />
Überhälter blieben stehen, die als Samenbäume eine Verjüngung einleiten sollten. Wiederaufforstungen<br />
unterblieben jedoch. Folge dieser "Lichtschlagwirtschaft" war eine wesentliche Veränderung der<br />
Baumartenzusammensetzung. Eichen und Buchen kamen nur noch spärlich aus Stockausschlägen auf,<br />
dagegen vermehrten sich jetzt durch Anflug, seltener durch Anpflanzung, Kiefer und Birke stark<br />
(GRÜNDEL 1951). In vielen <strong>Bereich</strong>en mit dicht verfilzter Heidekraut- und Heidelbeervegetation wurde<br />
jeglicher Gehölzaufwuchs unterdrückt.<br />
Nach Abzug der Franzosen begann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die langsame Erholung der<br />
Waldbestände, die in erster Linie durch den Wandel in der Landwirtschaft mit Einführung der<br />
Stallfütterung und die Ablösung des Brennholzes durch die Steinkohle ermöglicht wurde. Zunächst<br />
hemmte die Streunutzung die Regeneration der Wälder noch. Dabei wurde die jetzt nötige Einstreu für<br />
die Ställe in großen Mengen aus dem Wald geholt, und schon frühzeitig wurden z. B. im Stadtwald<br />
Kaiserslautern Forstverordnungen erlassen, die die Streunutzung reglementierten (BAUER &<br />
CHRISTMANN o. J.). So blieben die waldvernichtenden Auswirkungen der Streuentnahme im Vergleich<br />
zur Vorderpfalz gering. Gleichzeitig ging man allmählich wieder zu schonenderen Formen der<br />
Waldbewirtschaftung und zur Anlage von Forstkulturen über. Mit der Aufgabe der Streunutzung zu<br />
Beginn des 20. Jahrhunderts war der Prozess der Entflechtung von Land- und Forstwirtschaft, die bisher<br />
immer eng miteinander verknüpft waren, endgültig abgeschlossen. Das Erscheinungsbild der Wälder hat<br />
sich im Zuge dieser Entwicklungen in den letzten 100 Jahren von sehr lichten, zwergstrauchreichen<br />
Wäldern zu vielfach dicht geschlossenen Hochwäldern gewandelt.<br />
B.3.1.6.3 Der Übergang zur modernen Forstwirtschaft<br />
Erste Ansätze der Forstwirtschaft waren schon unter kurpfälzischer Herrschaft im 16. Jahrhundert in<br />
Kaiserslautern entwickelt. Dies hat sich auch auf die Wälder um Kaiserslautern ausgewirkt, in denen<br />
Forstordnungen die mittelalterlichen Waldverwüstungen im Vergleich zu anderen Regionen der Pfalz<br />
weniger schwerwiegend ausfallen ließen. Die 1774 in Kaiserslautern gegründete Kameralhochschule war<br />
eine der ersten Forstlehrstätten der Welt und wesentlich an der Entwicklung der Forstwissenschaft<br />
beteiligt (BAUER & CRISTMANN o. J.).<br />
Bereits um 1600 versuchte man durch gezielte Nachpflanzung eine nachhaltige Bewirtschaftung der<br />
übernutzten Wälder einzuführen (HÄBERLE 1913), gleichzeitig gab es erste Bestimmungen zur<br />
12 Den früheren Reichtum des Pfälzerwaldes an Heidelbeeren verdeutlicht die Tatsache, daß die Heidelbeerernte lange Zeit eine<br />
wichtige Nebenerwerbsquelle für die Bevölkerung war. In manchen Orten, besonders in der Vorderpfalz, war die<br />
Heidelbeerernte von so großer wirtschaftlicher Bedeutung, daß die Schulferien danach gelegt wurden (SEEBACH 1994).<br />
Heidelbeerreiche Wälder sind von besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz. Primär das Auerhuhn ist an die lichte<br />
Struktur von Heidelbeer-Wäldern optimal angpaßt bzw. existenziell darauf angewiesen (s. Steckbrief 15). Dieses Beispiel zeigt<br />
deutlich, in welch engem Beziehungsgeflecht und Abhängigkeitsverhältnis viele Tierarten in bezug zu menschlichen Nutzungen<br />
der Landschaft standen.