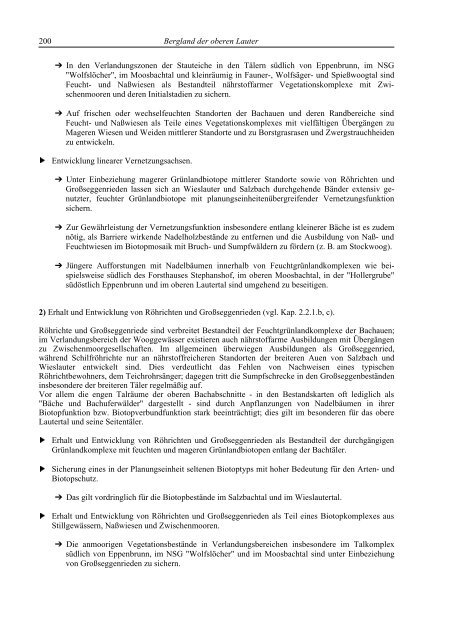Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
200 Bergland der oberen Lauter<br />
➔ In den Verlandungszonen der Stauteiche in den Tälern südlich von Eppenbrunn, im NSG<br />
"Wolfslöcher", im Moosbachtal und kleinräumig in Fauner-, Wolfsäger- und Spießwoogtal sind<br />
Feucht- und Naßwiesen als Bestandteil nährstoffarmer Vegetationskomplexe mit Zwischenmooren<br />
und deren Initialstadien zu sichern.<br />
➔ Auf frischen oder wechselfeuchten Standorten der Bachauen und deren Randbereiche sind<br />
Feucht- und Naßwiesen als Teile eines Vegetationskomplexes mit vielfältigen Übergängen zu<br />
Mageren Wiesen und Weiden mittlerer Standorte und zu Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden<br />
zu entwickeln.<br />
� Entwicklung linearer Vernetzungsachsen.<br />
➔ Unter Einbeziehung magerer Grünlandbiotope mittlerer Standorte sowie von Röhrichten und<br />
Großseggenrieden lassen sich an Wieslauter und Salzbach durchgehende Bänder extensiv genutzter,<br />
feuchter Grünlandbiotope mit planungseinheitenübergreifender Vernetzungsfunktion<br />
sichern.<br />
➔ Zur Gewährleistung der Vernetzungsfunktion insbesondere entlang kleinerer Bäche ist es zudem<br />
nötig, als Barriere wirkende Nadelholzbestände zu entfernen und die Ausbildung von Naß- und<br />
Feuchtwiesen im Biotopmosaik mit Bruch- und Sumpfwäldern zu fördern (z. B. am Stockwoog).<br />
➔ Jüngere Aufforstungen mit Nadelbäumen innerhalb von Feuchtgrünlandkomplexen wie beispielsweise<br />
südlich des Forsthauses Stephanshof, im oberen Moosbachtal, in der "Hollergrube"<br />
südöstlich Eppenbrunn und im oberen Lautertal sind umgehend zu beseitigen.<br />
2) Erhalt und Entwicklung von Röhrichten und Großseggenrieden (vgl. Kap. 2.2.1.b, c).<br />
Röhrichte und Großseggenriede sind verbreitet Bestandteil der Feuchtgrünlandkomplexe der Bachauen;<br />
im Verlandungsbereich der Wooggewässer existieren auch nährstoffarme Ausbildungen mit Übergängen<br />
zu Zwischenmoorgesellschaften. Im allgemeinen überwiegen Ausbildungen als Großseggenried,<br />
während Schilfröhrichte nur an nährstoffreicheren Standorten der breiteren Auen von Salzbach und<br />
Wieslauter entwickelt sind. Dies verdeutlicht das Fehlen von Nachweisen eines typischen<br />
Röhrichtbewohners, dem Teichrohrsänger; dagegen tritt die Sumpfschrecke in den Großseggenbeständen<br />
insbesondere der breiteren Täler regelmäßig auf.<br />
Vor allem die engen Talräume der oberen Bachabschnitte - in den Bestandskarten oft lediglich als<br />
"Bäche und Bachuferwälder" dargestellt - sind durch Anpflanzungen von Nadelbäumen in ihrer<br />
Biotopfunktion bzw. Biotopverbundfunktion stark beeinträchtigt; dies gilt im besonderen für das obere<br />
Lautertal und seine Seitentäler.<br />
� Erhalt und Entwicklung von Röhrichten und Großseggenrieden als Bestandteil der durchgängigen<br />
Grünlandkomplexe mit feuchten und mageren Grünlandbiotopen entlang der Bachtäler.<br />
� Sicherung eines in der <strong>Planung</strong>seinheit seltenen Biotoptyps mit hoher Bedeutung für den Arten- und<br />
Biotopschutz.<br />
➔ Das gilt vordringlich für die Biotopbestände im Salzbachtal und im Wieslautertal.<br />
� Erhalt und Entwicklung von Röhrichten und Großseggenrieden als Teil eines Biotopkomplexes aus<br />
Stillgewässern, Naßwiesen und Zwischenmooren.<br />
➔ Die anmoorigen Vegetationsbestände in Verlandungsbereichen insbesondere im Talkomplex<br />
südlich von Eppenbrunn, im NSG "Wolfslöcher" und im Moosbachtal sind unter Einbeziehung<br />
von Großseggenrieden zu sichern.