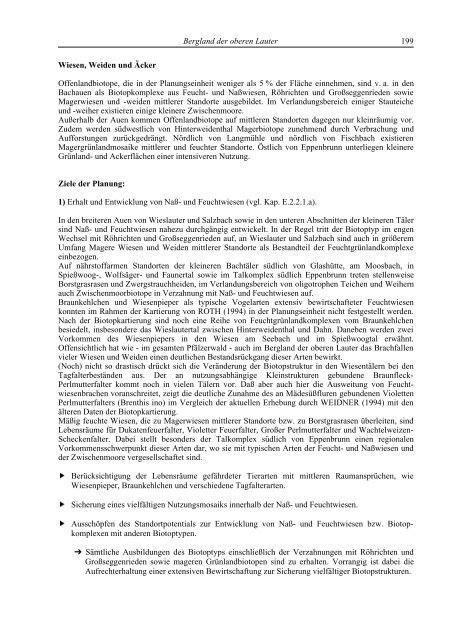Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Wiesen, Weiden und Äcker<br />
Bergland der oberen Lauter 199<br />
Offenlandbiotope, die in der <strong>Planung</strong>seinheit weniger als 5 % der Fläche einnehmen, sind v. a. in den<br />
Bachauen als Biotopkomplexe aus Feucht- und Naßwiesen, Röhrichten und Großseggenrieden sowie<br />
Magerwiesen und -weiden mittlerer Standorte ausgebildet. Im Verlandungsbereich einiger Stauteiche<br />
und -weiher existieren einige kleinere Zwischenmoore.<br />
Außerhalb der Auen kommen Offenlandbiotope auf mittleren Standorten dagegen nur kleinräumig vor.<br />
Zudem werden südwestlich von Hinterweidenthal Magerbiotope zunehmend durch Verbrachung und<br />
Aufforstungen zurückgedrängt. Nördlich von Langmühle und nördlich von Fischbach existieren<br />
Magergrünlandmosaike mittlerer und feuchter Standorte. Östlich von Eppenbrunn unterliegen kleinere<br />
Grünland- und Ackerflächen einer intensiveren Nutzung.<br />
Ziele der <strong>Planung</strong>:<br />
1) Erhalt und Entwicklung von Naß- und Feuchtwiesen (vgl. Kap. E.2.2.1.a).<br />
In den breiteren Auen von Wieslauter und Salzbach sowie in den unteren Abschnitten der kleineren Täler<br />
sind Naß- und Feuchtwiesen nahezu durchgängig entwickelt. In der Regel tritt der Biotoptyp im engen<br />
Wechsel mit Röhrichten und Großseggenrieden auf, an Wieslauter und Salzbach sind auch in größerem<br />
Umfang Magere Wiesen und Weiden mittlerer Standorte als Bestandteil der Feuchtgrünlandkomplexe<br />
einbezogen.<br />
Auf nährstoffarmen Standorten der kleineren Bachtäler südlich von Glashütte, am Moosbach, in<br />
Spießwoog-, Wolfsäger- und Faunertal sowie im Talkomplex südlich Eppenbrunn treten stellenweise<br />
Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden, im Verlandungsbereich von oligotrophen Teichen und Weihern<br />
auch Zwischenmoorbiotope in Verzahnung mit Naß- und Feuchtwiesen auf.<br />
Braunkehlchen und Wiesenpieper als typische Vogelarten extensiv bewirtschafteter Feuchtwiesen<br />
konnten im Rahmen der Kartierung von ROTH (1994) in der <strong>Planung</strong>seinheit nicht festgestellt werden.<br />
Nach der Biotopkartierung sind noch eine Reihe von Feuchtgrünlandkomplexen vom Braunkehlchen<br />
besiedelt, insbesondere das Wieslautertal zwischen Hinterweidenthal und Dahn. Daneben werden zwei<br />
Vorkommen des Wiesenpiepers in den Wiesen am Seebach und im Spießwoogtal erwähnt.<br />
Offensichtlich hat wie - im gesamten Pfälzerwald - auch im Bergland der oberen Lauter das Brachfallen<br />
vieler Wiesen und Weiden einen deutlichen Bestandsrückgang dieser Arten bewirkt.<br />
(Noch) nicht so drastisch drückt sich die Veränderung der Biotopstruktur in den Wiesentälern bei den<br />
Tagfalterbeständen aus. Der an nutzungsabhängige Kleinstrukturen gebundene Braunfleck-<br />
Perlmutterfalter kommt noch in vielen Tälern vor. Daß aber auch hier die Ausweitung von Feuchtwiesenbrachen<br />
voranschreitet, zeigt die deutliche Zunahme des an Mädesüßfluren gebundenen Violetten<br />
Perlmutterfalters (Brenthis ino) im Vergleich der aktuellen Erhebung durch WEIDNER (1994) mit den<br />
älteren Daten der Biotopkartierung.<br />
Mäßig feuchte Wiesen, die zu Magerwiesen mittlerer Standorte bzw. zu Borstgrasrasen überleiten, sind<br />
Lebensräume für Dukatenfeuerfalter, Violetter Feuerfalter, Großer Perlmutterfalter und Wachtelweizen-<br />
Scheckenfalter. Dabei stellt besonders der Talkomplex südlich von Eppenbrunn einen regionalen<br />
Vorkommensschwerpunkt dieser Arten dar, wo sie mit typischen Arten der Feucht- und Naßwiesen und<br />
der Zwischenmoore vergesellschaftet sind.<br />
� Berücksichtigung der Lebensräume gefährdeter Tierarten mit mittleren Raumansprüchen, wie<br />
Wiesenpieper, Braunkehlchen und verschiedene Tagfalterarten.<br />
� Sicherung eines vielfältigen Nutzungsmosaiks innerhalb der Naß- und Feuchtwiesen.<br />
� Ausschöpfen des Standortpotentials zur Entwicklung von Naß- und Feuchtwiesen bzw. Biotopkomplexen<br />
mit anderen Biotoptypen.<br />
➔ Sämtliche Ausbildungen des Biotoptyps einschließlich der Verzahnungen mit Röhrichten und<br />
Großseggenrieden sowie mageren Grünlandbiotopen sind zu erhalten. Vorrangig ist dabei die<br />
Aufrechterhaltung einer extensiven Bewirtschaftung zur Sicherung vielfältiger Biotopstrukturen.