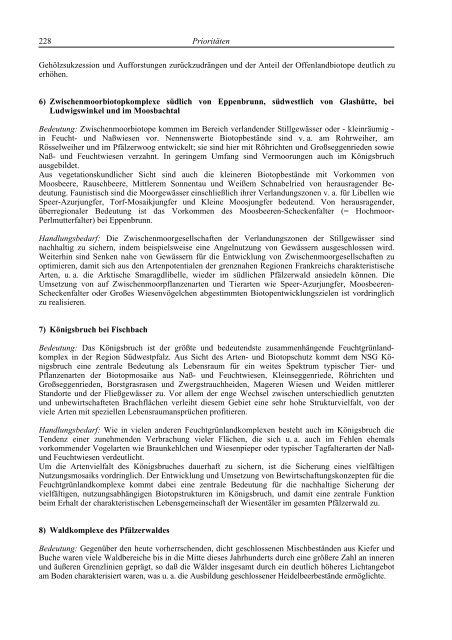Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
228 Prioritäten<br />
Gehölzsukzession und Aufforstungen zurückzudrängen und der Anteil der Offenlandbiotope deutlich zu<br />
erhöhen.<br />
6) Zwischenmoorbiotopkomplexe südlich von Eppenbrunn, südwestlich von Glashütte, bei<br />
Ludwigswinkel und im Moosbachtal<br />
Bedeutung: Zwischenmoorbiotope kommen im <strong>Bereich</strong> verlandender Stillgewässer oder - kleinräumig -<br />
in Feucht- und Naßwiesen vor. Nennenswerte Biotopbestände sind v. a. am Rohrweiher, am<br />
Rösselweiher und im Pfälzerwoog entwickelt; sie sind hier mit Röhrichten und Großseggenrieden sowie<br />
Naß- und Feuchtwiesen verzahnt. In geringem Umfang sind Vermoorungen auch im Königsbruch<br />
ausgebildet.<br />
Aus vegetationskundlicher Sicht sind auch die kleineren Biotopbestände mit Vorkommen von<br />
Moosbeere, Rauschbeere, Mittlerem Sonnentau und Weißem Schnabelried von herausragender Bedeutung.<br />
Faunistisch sind die Moorgewässer einschließlich ihrer Verlandungszonen v. a. für Libellen wie<br />
Speer-Azurjungfer, Torf-Mosaikjungfer und Kleine Moosjungfer bedeutend. Von herausragender,<br />
überregionaler Bedeutung ist das Vorkommen des Moosbeeren-Scheckenfalter (= Hochmoor-<br />
Perlmutterfalter) bei Eppenbrunn.<br />
Handlungsbedarf: Die Zwischenmoorgesellschaften der Verlandungszonen der Stillgewässer sind<br />
nachhaltig zu sichern, indem beispielsweise eine Angelnutzung von Gewässern ausgeschlossen wird.<br />
Weiterhin sind Senken nahe von Gewässern für die Entwicklung von Zwischenmoorgesellschaften zu<br />
optimieren, damit sich aus den Artenpotentialen der grenznahen Regionen Frankreichs charakteristische<br />
Arten, u. a. die Arktische Smaragdlibelle, wieder im südlichen Pfälzerwald ansiedeln können. Die<br />
Umsetzung von auf Zwischenmoorpflanzenarten und Tierarten wie Speer-Azurjungfer, Moosbeeren-<br />
Scheckenfalter oder Großes Wiesenvögelchen abgestimmten Biotopentwicklungszielen ist vordringlich<br />
zu realisieren.<br />
7) Königsbruch bei Fischbach<br />
Bedeutung: Das Königsbruch ist der größte und bedeutendste zusammenhängende Feuchtgrünlandkomplex<br />
in der Region <strong>Südwestpfalz</strong>. Aus Sicht des Arten- und Biotopschutz kommt dem NSG Königsbruch<br />
eine zentrale Bedeutung als Lebensraum für ein weites Spektrum typischer Tier- und<br />
Pflanzenarten der Biotopmosaike aus Naß- und Feuchtwiesen, Kleinseggenriede, Röhrichten und<br />
Großseggenrieden, Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden, Mageren Wiesen und Weiden mittlerer<br />
Standorte und der Fließgewässer zu. Vor allem der enge Wechsel zwischen unterschiedlich genutzten<br />
und unbewirtschafteten Brachflächen verleiht diesem Gebiet eine sehr hohe Strukturvielfalt, von der<br />
viele Arten mit speziellen Lebensraumansprüchen profitieren.<br />
Handlungsbedarf: Wie in vielen anderen Feuchtgrünlandkomplexen besteht auch im Königsbruch die<br />
Tendenz einer zunehmenden Verbrachung vieler Flächen, die sich u. a. auch im Fehlen ehemals<br />
vorkommender Vogelarten wie Braunkehlchen und Wiesenpieper oder typischer Tagfalterarten der Naßund<br />
Feuchtwiesen verdeutlicht.<br />
Um die Artenvielfalt des Königsbruches dauerhaft zu sichern, ist die Sicherung eines vielfältigen<br />
Nutzungsmosaiks vordringlich. Der Entwicklung und Umsetzung von Bewirtschaftungskonzepten für die<br />
Feuchtgrünlandkomplexe kommt dabei eine zentrale Bedeutung für die nachhaltige Sicherung der<br />
vielfältigen, nutzungsabhängigen Biotopstrukturen im Königsbruch, und damit eine zentrale Funktion<br />
beim Erhalt der charakteristischen Lebensgemeinschaft der Wiesentäler im gesamten Pfälzerwald zu.<br />
8) Waldkomplexe des Pfälzerwaldes<br />
Bedeutung: Gegenüber den heute vorherrschenden, dicht geschlossenen Mischbeständen aus Kiefer und<br />
Buche waren viele Waldbereiche bis in die Mitte dieses Jahrhunderts durch eine größere Zahl an inneren<br />
und äußeren Grenzlinien geprägt, so daß die Wälder insgesamt durch ein deutlich höheres Lichtangebot<br />
am Boden charakterisiert waren, was u. a. die Ausbildung geschlossener Heidelbeerbestände ermöglichte.