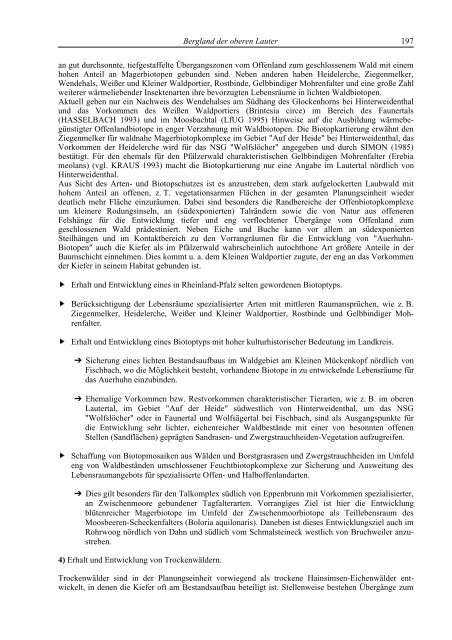Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Südwestpfalz ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bergland der oberen Lauter 197<br />
an gut durchsonnte, tiefgestaffelte Übergangszonen vom Offenland zum geschlossenem Wald mit einem<br />
hohen Anteil an Magerbiotopen gebunden sind. Neben anderen haben Heidelerche, Ziegenmelker,<br />
Wendehals, Weißer und Kleiner Waldportier, Rostbinde, Gelbbindiger Mohrenfalter und eine große Zahl<br />
weiterer wärmeliebender Insektenarten ihre bevorzugten Lebensräume in lichten Waldbiotopen.<br />
Aktuell geben nur ein Nachweis des Wendehalses am Südhang des Glockenhorns bei Hinterweidenthal<br />
und das Vorkommen des Weißen Waldportiers (Brintesia circe) im <strong>Bereich</strong> des Faunertals<br />
(HASSELBACH 1993) und im Moosbachtal (LfUG 1995) Hinweise auf die Ausbildung wärmebegünstigter<br />
Offenlandbiotope in enger Verzahnung mit Waldbiotopen. Die Biotopkartierung erwähnt den<br />
Ziegenmelker für waldnahe Magerbiotopkomplexe im Gebiet "Auf der Heide" bei Hinterweidenthal, das<br />
Vorkommen der Heidelerche wird für das NSG "Wolfslöcher" angegeben und durch SIMON (1985)<br />
bestätigt. Für den ehemals für den Pfälzerwald charakteristischen Gelbbindigen Mohrenfalter (Erebia<br />
meolans) (vgl. KRAUS 1993) macht die Biotopkartierung nur eine Angabe im Lautertal nördlich von<br />
Hinterweidenthal.<br />
Aus Sicht des Arten- und Biotopschutzes ist es anzustreben, dem stark aufgelockerten Laubwald mit<br />
hohem Anteil an offenen, z. T. vegetationsarmen Flächen in der gesamten <strong>Planung</strong>seinheit wieder<br />
deutlich mehr Fläche einzuräumen. Dabei sind besonders die Randbereiche der Offenbiotopkomplexe<br />
um kleinere Rodungsinseln, an (südexponierten) Talrändern sowie die von Natur aus offeneren<br />
Felshänge für die Entwicklung tiefer und eng verflochtener Übergänge vom Offenland zum<br />
geschlossenen Wald prädestiniert. Neben Eiche und Buche kann vor allem an südexponierten<br />
Steilhängen und im Kontaktbereich zu den Vorrangräumen für die Entwicklung von "Auerhuhn-<br />
Biotopen" auch die Kiefer als im Pfälzerwald wahrscheinlich autochthone Art größere Anteile in der<br />
Baumschicht einnehmen. Dies kommt u. a. dem Kleinen Waldportier zugute, der eng an das Vorkommen<br />
der Kiefer in seinem Habitat gebunden ist.<br />
� Erhalt und Entwicklung eines in Rheinland-Pfalz selten gewordenen Biotoptyps.<br />
� Berücksichtigung der Lebensräume spezialisierter Arten mit mittleren Raumansprüchen, wie z. B.<br />
Ziegenmelker, Heidelerche, Weißer und Kleiner Waldportier, Rostbinde und Gelbbindiger Mohrenfalter.<br />
� Erhalt und Entwicklung eines Biotoptyps mit hoher kulturhistorischer Bedeutung im <strong>Landkreis</strong>.<br />
➔ Sicherung eines lichten Bestandsaufbaus im Waldgebiet am Kleinen Mückenkopf nördlich von<br />
Fischbach, wo die Möglichkeit besteht, vorhandene Biotope in zu entwickelnde Lebensräume für<br />
das Auerhuhn einzubinden.<br />
➔ Ehemalige Vorkommen bzw. Restvorkommen charakteristischer Tierarten, wie z. B. im oberen<br />
Lautertal, im Gebiet "Auf der Heide" südwestlich von Hinterweidenthal, um das NSG<br />
"Wolfslöcher" oder in Faunertal und Wolfsägertal bei Fischbach, sind als Ausgangspunkte für<br />
die Entwicklung sehr lichter, eichenreicher Waldbestände mit einer von besonnten offenen<br />
Stellen (Sandflächen) geprägten Sandrasen- und Zwergstrauchheiden-Vegetation aufzugreifen.<br />
� Schaffung von Biotopmosaiken aus Wälden und Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden im Umfeld<br />
eng von Waldbeständen umschlossener Feuchtbiotopkomplexe zur Sicherung und Ausweitung des<br />
Lebensraumangebots für spezialisierte Offen- und Halboffenlandarten.<br />
➔ Dies gilt besonders für den Talkomplex südlich von Eppenbrunn mit Vorkommen spezialisierter,<br />
an Zwischenmoore gebundener Tagfalterarten. Vorrangiges Ziel ist hier die Entwicklung<br />
blütenreicher Magerbiotope im Umfeld der Zwischenmoorbiotope als Teillebensraum des<br />
Moosbeeren-Scheckenfalters (Boloria aquilonaris). Daneben ist dieses Entwicklungsziel auch im<br />
Rohrwoog nördlich von Dahn und südlich vom Schmalsteineck westlich von Bruchweiler anzustreben.<br />
4) Erhalt und Entwicklung von Trockenwäldern.<br />
Trockenwälder sind in der <strong>Planung</strong>seinheit vorwiegend als trockene Hainsimsen-Eichenwälder entwickelt,<br />
in denen die Kiefer oft am Bestandsaufbau beteiligt ist. Stellenweise bestehen Übergänge zum