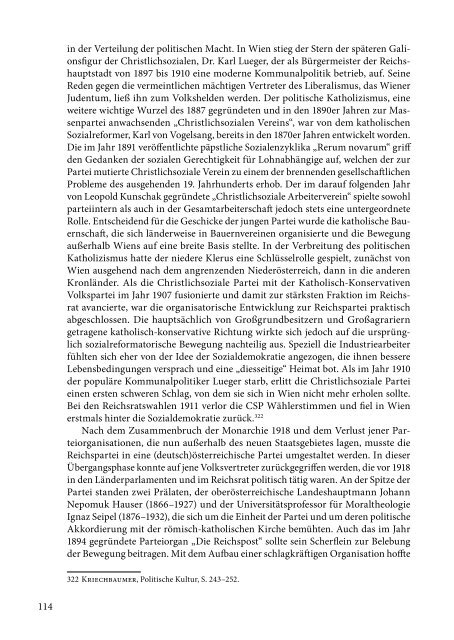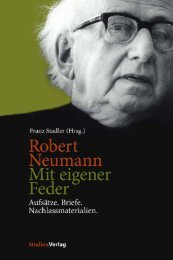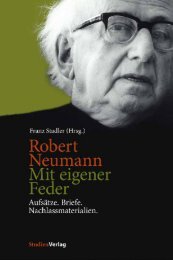Marina Brandtner Diskursverweigerung und Gewalt
Marina Brandtner Diskursverweigerung und Gewalt
Marina Brandtner Diskursverweigerung und Gewalt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
114<br />
in der Verteilung der politischen Macht. In Wien stieg der Stern der späteren Galionsfigur<br />
der Christlichsozialen, Dr. Karl Lueger, der als Bürgermeister der Reichshauptstadt<br />
von 1897 bis 1910 eine moderne Kommunalpolitik betrieb, auf. Seine<br />
Reden gegen die vermeintlichen mächtigen Vertreter des Liberalismus, das Wiener<br />
Judentum, ließ ihn zum Volkshelden werden. Der politische Katholizismus, eine<br />
weitere wichtige Wurzel des 1887 gegründeten <strong>und</strong> in den 1890er Jahren zur Massenpartei<br />
anwachsenden „Christlichsozialen Vereins“, war von dem katholischen<br />
Sozialreformer, Karl von Vogelsang, bereits in den 1870er Jahren entwickelt worden.<br />
Die im Jahr 1891 veröffentlichte päpstliche Sozialenzyklika „Rerum novarum“ griff<br />
den Gedanken der sozialen Gerechtigkeit für Lohnabhängige auf, welchen der zur<br />
Partei mutierte Christlichsoziale Verein zu einem der brennenden gesellschaftlichen<br />
Probleme des ausgehenden 19. Jahrh<strong>und</strong>erts erhob. Der im darauf folgenden Jahr<br />
von Leopold Kunschak gegründete „Christlichsoziale Arbeiterverein“ spielte sowohl<br />
parteiintern als auch in der Gesamtarbeiterschaft jedoch stets eine untergeordnete<br />
Rolle. Entscheidend für die Geschicke der jungen Partei wurde die katholische Bauernschaft,<br />
die sich länderweise in Bauernvereinen organisierte <strong>und</strong> die Bewegung<br />
außerhalb Wiens auf eine breite Basis stellte. In der Verbreitung des politischen<br />
Katholizismus hatte der niedere Klerus eine Schlüsselrolle gespielt, zunächst von<br />
Wien ausgehend nach dem angrenzenden Niederösterreich, dann in die anderen<br />
Kronländer. Als die Christlichsoziale Partei mit der Katholisch-Konservativen<br />
Volkspartei im Jahr 1907 fusionierte <strong>und</strong> damit zur stärksten Fraktion im Reichsrat<br />
avancierte, war die organisatorische Entwicklung zur Reichspartei praktisch<br />
abgeschlossen. Die hauptsächlich von Großgr<strong>und</strong>besitzern <strong>und</strong> Großagrariern<br />
getragene katholisch-konservative Richtung wirkte sich jedoch auf die ursprünglich<br />
sozialreformatorische Bewegung nachteilig aus. Speziell die Industriearbeiter<br />
fühlten sich eher von der Idee der Sozialdemokratie angezogen, die ihnen bessere<br />
Lebensbedingungen versprach <strong>und</strong> eine „diesseitige“ Heimat bot. Als im Jahr 1910<br />
der populäre Kommunalpolitiker Lueger starb, erlitt die Christlichsoziale Partei<br />
einen ersten schweren Schlag, von dem sie sich in Wien nicht mehr erholen sollte.<br />
Bei den Reichsratswahlen 1911 verlor die CSP Wählerstimmen <strong>und</strong> fiel in Wien<br />
erstmals hinter die Sozialdemokratie zurück. 322<br />
Nach dem Zusammenbruch der Monarchie 1918 <strong>und</strong> dem Verlust jener Parteiorganisationen,<br />
die nun außerhalb des neuen Staatsgebietes lagen, musste die<br />
Reichspartei in eine (deutsch)österreichische Partei umgestaltet werden. In dieser<br />
Übergangsphase konnte auf jene Volksvertreter zurückgegriffen werden, die vor 1918<br />
in den Länderparlamenten <strong>und</strong> im Reichsrat politisch tätig waren. An der Spitze der<br />
Partei standen zwei Prälaten, der oberösterreichische Landeshauptmann Johann<br />
Nepomuk Hauser (1866–1927) <strong>und</strong> der Universitätsprofessor für Moraltheologie<br />
Ignaz Seipel (1876–1932), die sich um die Einheit der Partei <strong>und</strong> um deren politische<br />
Akkordierung mit der römisch-katholischen Kirche bemühten. Auch das im Jahr<br />
1894 gegründete Parteiorgan „Die Reichspost“ sollte sein Scherflein zur Belebung<br />
der Bewegung beitragen. Mit dem Aufbau einer schlagkräftigen Organisation hoffte<br />
322 Kriechbaumer, Politische Kultur, S. 243–252.