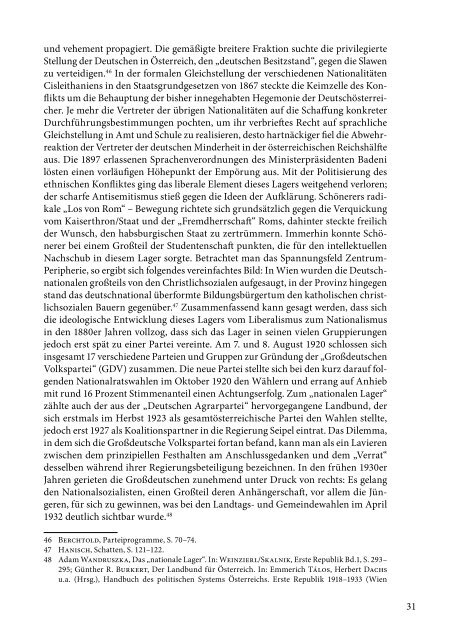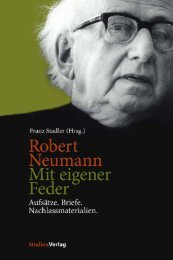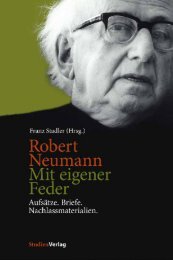Marina Brandtner Diskursverweigerung und Gewalt
Marina Brandtner Diskursverweigerung und Gewalt
Marina Brandtner Diskursverweigerung und Gewalt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>und</strong> vehement propagiert. Die gemäßigte breitere Fraktion suchte die privilegierte<br />
Stellung der Deutschen in Österreich, den „deutschen Besitzstand“, gegen die Slawen<br />
zu verteidigen. 46 In der formalen Gleichstellung der verschiedenen Nationalitäten<br />
Cisleithaniens in den Staatsgr<strong>und</strong>gesetzen von 1867 steckte die Keimzelle des Konflikts<br />
um die Behauptung der bisher innegehabten Hegemonie der Deutschösterreicher.<br />
Je mehr die Vertreter der übrigen Nationalitäten auf die Schaffung konkreter<br />
Durchführungsbestimmungen pochten, um ihr verbrieftes Recht auf sprachliche<br />
Gleichstellung in Amt <strong>und</strong> Schule zu realisieren, desto hartnäckiger fiel die Abwehrreaktion<br />
der Vertreter der deutschen Minderheit in der österreichischen Reichshälfte<br />
aus. Die 1897 erlassenen Sprachenverordnungen des Ministerpräsidenten Badeni<br />
lösten einen vorläufigen Höhepunkt der Empörung aus. Mit der Politisierung des<br />
ethnischen Konfliktes ging das liberale Element dieses Lagers weitgehend verloren;<br />
der scharfe Antisemitismus stieß gegen die Ideen der Aufklärung. Schönerers radikale<br />
„Los von Rom“ – Bewegung richtete sich gr<strong>und</strong>sätzlich gegen die Verquickung<br />
vom Kaiserthron/Staat <strong>und</strong> der „Fremdherrschaft“ Roms, dahinter steckte freilich<br />
der Wunsch, den habsburgischen Staat zu zertrümmern. Immerhin konnte Schönerer<br />
bei einem Großteil der Studentenschaft punkten, die für den intellektuellen<br />
Nachschub in diesem Lager sorgte. Betrachtet man das Spannungsfeld Zentrum-<br />
Peripherie, so ergibt sich folgendes vereinfachtes Bild: In Wien wurden die Deutschnationalen<br />
großteils von den Christlichsozialen aufgesaugt, in der Provinz hingegen<br />
stand das deutschnational überformte Bildungsbürgertum den katholischen christlichsozialen<br />
Bauern gegenüber. 47 Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich<br />
die ideologische Entwicklung dieses Lagers vom Liberalismus zum Nationalismus<br />
in den 1880er Jahren vollzog, dass sich das Lager in seinen vielen Gruppierungen<br />
jedoch erst spät zu einer Partei vereinte. Am 7. <strong>und</strong> 8. August 1920 schlossen sich<br />
insgesamt 17 verschiedene Parteien <strong>und</strong> Gruppen zur Gründung der „Großdeutschen<br />
Volkspartei“ (GDV) zusammen. Die neue Partei stellte sich bei den kurz darauf folgenden<br />
Nationalratswahlen im Oktober 1920 den Wählern <strong>und</strong> errang auf Anhieb<br />
mit r<strong>und</strong> 16 Prozent Stimmenanteil einen Achtungserfolg. Zum „nationalen Lager“<br />
zählte auch der aus der „Deutschen Agrarpartei“ hervorgegangene Landb<strong>und</strong>, der<br />
sich erstmals im Herbst 1923 als gesamtösterreichische Partei den Wahlen stellte,<br />
jedoch erst 1927 als Koalitionspartner in die Regierung Seipel eintrat. Das Dilemma,<br />
in dem sich die Großdeutsche Volkspartei fortan befand, kann man als ein Lavieren<br />
zwischen dem prinzipiellen Festhalten am Anschlussgedanken <strong>und</strong> dem „Verrat“<br />
desselben während ihrer Regierungsbeteiligung bezeichnen. In den frühen 1930er<br />
Jahren gerieten die Großdeutschen zunehmend unter Druck von rechts: Es gelang<br />
den Nationalsozialisten, einen Großteil deren Anhängerschaft, vor allem die Jüngeren,<br />
für sich zu gewinnen, was bei den Landtags- <strong>und</strong> Gemeindewahlen im April<br />
1932 deutlich sichtbar wurde. 48<br />
46 Berchtold, Parteiprogramme, S. 70–74.<br />
47 Hanisch, Schatten, S. 121–122.<br />
48 Adam Wandruszka, Das „nationale Lager“. In: Weinzierl/Skalnik, Erste Republik Bd.1, S. 293–<br />
295; Günther R. Burkert, Der Landb<strong>und</strong> für Österreich. In: Emmerich Tálos, Herbert Dachs<br />
u.a. (Hrsg.), Handbuch des politischen Systems Österreichs. Erste Republik 1918–1933 (Wien<br />
31