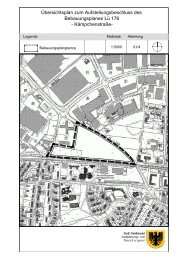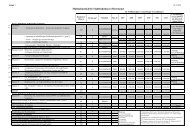- Seite 1:
Sozialräumliche Jugendhilfeplanung
- Seite 5 und 6:
Bestandsaufnahme 1. Sozialstatistis
- Seite 7 und 8:
1.2.2. Anteil von Kindern und Jugen
- Seite 9 und 10:
1.3. Materielle Situation Der Bezug
- Seite 11 und 12:
möglichen Bedarf an Beratung und B
- Seite 13 und 14:
Bereiche / Sozialräume Kinderzahl
- Seite 15 und 16:
2.1.1. Kindertageseinrichtungen im
- Seite 17 und 18:
2.1.3. Kindertageseinrichtungen im
- Seite 19 und 20:
2.1.5. Einschätzung der Angebotsst
- Seite 21 und 22:
2.2.2. Angebote der Kinder- und Jug
- Seite 23 und 24:
Name der Einrichtung Kath. Franzisk
- Seite 25 und 26:
Scharnhorst, Paul-Dohrmann-Schule,
- Seite 27 und 28:
Spielmöglichkeiten; außerdem best
- Seite 29 und 30:
2.4.4. Angebote im Sozialraum Schar
- Seite 31 und 32:
2.5.2. Freizeitangebote der Vereine
- Seite 33 und 34:
Verein Angebot Öffnungszeiten Teil
- Seite 35 und 36:
2.6. Sozialraumübergreifende Angeb
- Seite 37 und 38:
3. Daten zu Aktivitäten der erzieh
- Seite 39 und 40:
Versorgungsinfrastruktur In Kirchde
- Seite 41 und 42:
Versorgungsinfrastruktur In Derne l
- Seite 43 und 44:
Der Ortsteil Grevel Der kleine Orts
- Seite 45 und 46:
4.2. Bewertung im Sozialraum Husen/
- Seite 47 und 48:
Als Schwächen und Probleme des Ort
- Seite 49 und 50:
kaum beziehungsweise gar keine Gesc
- Seite 51 und 52:
Es gibt immer wieder Rivalitäten u
- Seite 53 und 54:
Grünflächen Es gibt viele große
- Seite 55 und 56:
4.3.3. Bewertung der Lebensbedingun
- Seite 57 und 58:
Versorgungsinfrastruktur Scharnhors
- Seite 59 und 60:
auch an mangelnder Integration. Ger
- Seite 61 und 62:
5.1.2. Bedarfanmeldungen und Anford
- Seite 63 und 64:
erst um 15:00 Uhr beziehungsweise u
- Seite 65 und 66:
5.5.2. Qualifikation für Elternarb
- Seite 67 und 68:
Beteiligte Akteure der Planungsproz
- Seite 69:
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
- Seite 73:
Inhaltsverzeichnis Bestandsaufnahme
- Seite 76 und 77:
Seite 6 Tabelle Anteile der Minderj
- Seite 78 und 79:
Seite 8 Tabelle Anteile der Kinder,
- Seite 80 und 81:
1.3.2. Arbeitslosenstatistik Der St
- Seite 82 und 83:
2. Bestand an Einrichtungen 2.1. Ki
- Seite 84 und 85:
Bei der Versorgungsquote mit Plätz
- Seite 86 und 87:
2.1.2. Kindertageseinrichtungen im
- Seite 88 und 89:
2.1.4. Kindertageseinrichtungen im
- Seite 90 und 91:
Wickede verfügt im Sozialraum übe
- Seite 92 und 93:
2.2.2. Angebote der Kinder- und Jug
- Seite 94 und 95:
Name der Einrichtung Ev. Jugend Wic
- Seite 96 und 97:
2.3. Spielplätze im Stadtbezirk Br
- Seite 98 und 99:
2.4.3. Angebote im Sozialraum Wambe
- Seite 100 und 101:
2.5.3. Freizeitangebote der Vereine
- Seite 102 und 103:
Beratungsstelle für Kinder, Jugend
- Seite 104 und 105:
3. Daten zu Aktivitäten der erzieh
- Seite 106 und 107:
4. Aspekte zur Beschreibung der Leb
- Seite 108 und 109:
4.1.4. Bewertung der Lebensbedingun
- Seite 110 und 111:
Ebenso positiv ist im Sozialraum Br
- Seite 112 und 113:
Als besonders positiv wurden die fl
- Seite 114 und 115:
Die Versorgung mit Schulen ist als
- Seite 116 und 117:
Bedarfseinschätzung und Maßnahmen
- Seite 118 und 119:
Für Brackeler Eltern ist das Angeb
- Seite 120 und 121:
5.4. Sozialraum Wickede 5.4.1. Beda
- Seite 122 und 123:
Bedingt durch Berufstätigkeit ist
- Seite 124 und 125:
14 Sozialhilfedienst Brackeler Hell
- Seite 127:
Inhaltsverzeichnis Bestandsaufnahme
- Seite 130 und 131:
Bei einem Vergleich der einzelnen P
- Seite 132 und 133:
1.2.2. Anteil von Kindern und Jugen
- Seite 134 und 135:
1.3. 1.3.1. Materielle Situation De
- Seite 136 und 137:
esondere Anforderungen an die Jugen
- Seite 138 und 139:
Bei den Versorgungsquoten mit Plät
- Seite 140 und 141:
Name der Einrichtung Städt. Kinder
- Seite 142 und 143:
Die soziale Struktur in diesen beid
- Seite 144 und 145:
Name der Einrichtung Jugendfreizeit
- Seite 146 und 147:
2.3. Spielplätze im Stadtbezirk Ev
- Seite 148 und 149:
Die Graf-Konrad-Grundschule im Sozi
- Seite 150 und 151:
Verein Angebot Öffnungszeiten Teil
- Seite 152 und 153:
Beratungsstelle für Kinder, Jugend
- Seite 154 und 155:
3.2. Jugendgerichtshilfe Bereiche /
- Seite 156 und 157:
Stündliche Busverbindungen bestehe
- Seite 158 und 159:
4.2. 4.2.1. Bewertung im Sozialraum
- Seite 160 und 161:
Das Vereinsleben ist ausgeprägt; e
- Seite 162 und 163:
Von Schulte-Röding aus verkehrt di
- Seite 164 und 165:
Bedarfseinschätzung und Maßnahmen
- Seite 166 und 167:
5.3. Sozialraum Eving I/Kemminghaus
- Seite 168 und 169:
Seite 44
- Seite 170 und 171:
13 TEK Grävingholz Grävingholzstr
- Seite 173:
Inhaltsverzeichnis Bestandsaufnahme
- Seite 176 und 177:
1.2.1. Altersstruktur Der Anteil de
- Seite 178 und 179:
1.2.2. Anteil von Kindern und Jugen
- Seite 180 und 181:
1.3. Materielle Situation Der Bezug
- Seite 182 und 183:
möglichen Bedarf an Beratung und B
- Seite 184 und 185:
Bereiche / Sozialräume Kinderzahl
- Seite 186 und 187:
2.1.1. Kindertageseinrichtungen im
- Seite 188 und 189:
Name der Einrichtung Ev. Kindergart
- Seite 190 und 191:
2.2. Angebote der Kinder- und Jugen
- Seite 192 und 193:
Name der Einrichtung Skatertreff Ho
- Seite 194 und 195:
2.4. Angebote der Jugendhilfe in Ko
- Seite 196 und 197:
2.4.3. Angebote im Sozialraum Höch
- Seite 198 und 199:
TuS Borussia Höchsten Verein Angeb
- Seite 200 und 201:
Verschiedene Projekte mit dem Jugen
- Seite 202 und 203:
3.2. Jugendgerichtshilfe Bereiche /
- Seite 204 und 205:
4.1.1. Wichlinghofen Hier findet ma
- Seite 206 und 207:
Nahverkehrsanbindungen zu benachbar
- Seite 208 und 209:
Bewertung der Lebensbedingungen fü
- Seite 210 und 211:
Sportverein und Teiloffene Tür der
- Seite 212 und 213:
gemacht. Die Einrichtung von Eltern
- Seite 214 und 215:
Verkehrssituation Der ÖPNV (Bus) e
- Seite 216 und 217:
den damit verbundenen sportlichen A
- Seite 218 und 219:
4.3.1. Syburg - Buchholz Die Ortste
- Seite 220 und 221:
Das Quartier bietet eine gute Infra
- Seite 222 und 223:
Bedarfseinschätzung und Maßnahmen
- Seite 224 und 225:
5.2.5. Verbesserung der Aufenthalts
- Seite 226 und 227:
Seite 56
- Seite 228 und 229:
11 Kath. Kindergarten "Herz Jesu" E
- Seite 231:
Inhaltsverzeichnis Bestandsaufnahme
- Seite 234 und 235:
Seite 6 Tabelle Anteile der Minderj
- Seite 236 und 237:
Seite 8 Tabelle Anteile der Kinder,
- Seite 238 und 239:
1.3.2. Arbeitslosenstatistik Der St
- Seite 240 und 241:
2. Bestand an Einrichtungen 2.1. Ki
- Seite 242 und 243:
2.1.1. Kindertageseinrichtungen im
- Seite 244 und 245:
2.1.3. Kindertageseinrichtungen im
- Seite 246 und 247:
übernehmen, ohne die die Arbeit ni
- Seite 248 und 249:
2.2.4. Einschätzung der Angebotsst
- Seite 250 und 251:
2.3. Spielplätze im Stadtbezirk Ho
- Seite 252 und 253:
2.4.3. Angebote im Sozialraum Kirch
- Seite 254 und 255:
2.5.2. Freizeitangebote der Vereine
- Seite 256 und 257:
Die Öffnungszeiten sind montags bi
- Seite 258 und 259:
3. Daten zu Aktivitäten der erzieh
- Seite 260 und 261:
4. Aspekte zur Beschreibung der Leb
- Seite 262 und 263:
Honorarkräfte. Ein gutes Abstimmun
- Seite 264 und 265:
In Menglinghausen gibt es weder ein
- Seite 266 und 267:
Im Ortsteil Löttringhausen wohnen
- Seite 268 und 269:
Bedarfseinschätzung und Maßnahmen
- Seite 270 und 271:
5.2. Sozialraum Menglinghausen 5.2.
- Seite 272 und 273:
5.3.3. Ortsnahe Unterbringung von K
- Seite 274 und 275:
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
- Seite 277:
Sozialräumliche Jugendhilfeplanung
- Seite 281 und 282:
Bestandsaufnahme 1. Sozialstatistis
- Seite 283 und 284:
1.2.2. Anteil von Kindern und Jugen
- Seite 285 und 286:
1.3. Materielle Situation Der Bezug
- Seite 287 und 288:
möglichen Bedarf an Beratung und B
- Seite 289 und 290:
Bei den Versorgungsquoten mit Plät
- Seite 291 und 292:
2.1.2. Kindertageseinrichtungen im
- Seite 293 und 294:
2.2. Angebote der Kinder- und Jugen
- Seite 295 und 296:
Name der Einrichtung Jugendkeller d
- Seite 297 und 298:
2.3. Spielplätze im Stadtbezirk Hu
- Seite 299 und 300:
2.4.3. Einschätzung der Angebotsst
- Seite 301 und 302:
2.5.3. Einschätzung zur Angebotsst
- Seite 303 und 304:
intensivieren, möchte die Biblioth
- Seite 305 und 306:
4. Aspekte zur Beschreibung der Leb
- Seite 307 und 308:
Kennzeichen für Deusen sind seine
- Seite 309 und 310:
ähnliches sind nicht vorhanden. F
- Seite 311 und 312:
Treffpunkt für jugendliche Cliquen
- Seite 313 und 314:
Bedarfseinschätzung und Maßnahmen
- Seite 315 und 316:
5.1.1.11. Hilfestellungen für Elte
- Seite 317 und 318:
im schulischen Sozial- und Lernkont
- Seite 319 und 320:
5.2.2.3. Schaffung von zusätzliche
- Seite 321 und 322:
Beteiligte Akteure der Planungsproz
- Seite 323:
Sozialräumliche Jugendhilfeplanung
- Seite 327 und 328:
Bestandsaufnahme 1. Sozialstatistis
- Seite 329 und 330: 1.2.2. Anteil von Kindern und Jugen
- Seite 331 und 332: 1.3. Materielle Situation Der Bezug
- Seite 333 und 334: möglichen Bedarf an Beratung und B
- Seite 335 und 336: Bereiche / Sozialräume Kinderzahl
- Seite 337 und 338: 2.1.1. Kindertageseinrichtungen im
- Seite 339 und 340: Die Einrichtungen im Sozialraum zei
- Seite 341 und 342: fehlt es aus Sicht der Planungsgrup
- Seite 343 und 344: Name der Einrichtung TOT - Ev. Mark
- Seite 345 und 346: Die Ausstattung aller Jugendfreizei
- Seite 347 und 348: 2.3. Spielplätze im Stadtbezirk In
- Seite 349 und 350: 2.4. Angebote der Jugendhilfe in Ko
- Seite 351 und 352: 2.4.3. Angebote im Sozialraum Borsi
- Seite 353 und 354: 2.5.3. Freizeitangebote der Vereine
- Seite 355 und 356: INSTITUTION ANGEBOTE/AUFGABEN ÖFFN
- Seite 357 und 358: Für den Sozialraum Nordmarkt wurde
- Seite 359 und 360: Teilnehmende Einrichtungen im Kurz
- Seite 361 und 362: 4. Aspekte zur Beschreibung der Leb
- Seite 363 und 364: Heute bieten alle Grundschulen im S
- Seite 365 und 366: Das Schwimmbad im Dietrich-Keuning-
- Seite 367 und 368: 4.3. Bewertung im Sozialraum Borsig
- Seite 369 und 370: außerhalb von Einrichtungen werden
- Seite 371 und 372: 5.1.1.4. Betreuungsangebot für Kin
- Seite 373 und 374: 5.2.1.4. Freizeitangebote für die
- Seite 375 und 376: 5.3.1.4. Abstimmung und Ergänzung
- Seite 377 und 378: Anhang 6.1. Das sozialpädagogische
- Seite 379: Anhang 6.2. Lebens- und Aktionsräu
- Seite 383 und 384: Wo triffst du dich mit Freunden? Ge
- Seite 385 und 386: Projekt III Stadtteilerkundung mit
- Seite 387 und 388: Resümee Abschließend zeigt sich e
- Seite 389 und 390: Beteiligte Akteure der Planungsproz
- Seite 391: Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
- Seite 395: Inhaltsverzeichnis Bestandsaufnahme
- Seite 398 und 399: Seite 6 Tabelle Anteile der Minderj
- Seite 400 und 401: Seite 8 Tabelle Anteile der Kinder,
- Seite 402 und 403: 1.3.2. Arbeitslosenstatistik Der St
- Seite 404 und 405: 2. Bestand an Einrichtungen 2.1. Ki
- Seite 406 und 407: 2.1.1. Kindertageseinrichtungen im
- Seite 408 und 409: 2.1.3. Einschätzung der Angebotsst
- Seite 410 und 411: Name der Einrichtung Kath. Kircheng
- Seite 412 und 413: höchstens eine/n hauptamtliche/n M
- Seite 414 und 415: 2.4. Angebote der Jugendhilfe in Ko
- Seite 416 und 417: 2.5.2. Freizeitangebote der Vereine
- Seite 418 und 419: Name der Einrichtung Jugendkontaktb
- Seite 420 und 421: Nicht tabellarisch wurden folgende
- Seite 422 und 423: 3. Daten zu Aktivitäten der erzieh
- Seite 424 und 425: Der Wohnbereich Gartenstadt des Soz
- Seite 426 und 427: Jugendfreizeitstätten mit entsprec
- Seite 428 und 429: Musikschule angeboten. Regelmäßig
- Seite 430 und 431:
so, dass Eltern im Stadtbezirk Inne
- Seite 432 und 433:
5.2. Sozialraum Südliche Gartensta
- Seite 434 und 435:
Hier sollten klare Grenzen gezogen
- Seite 436 und 437:
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
- Seite 439:
Inhaltsverzeichnis Bestandsaufnahme
- Seite 442 und 443:
Bereiche / Sozialräume Bevölkerun
- Seite 444 und 445:
1.2.2. Anteil von Kindern und Jugen
- Seite 446 und 447:
1.3. 1.3.1. Materielle Situation De
- Seite 448 und 449:
Ersatzdatum für den Anteil der all
- Seite 450 und 451:
Bereiche / Sozialräume Kinderzahl
- Seite 452 und 453:
2.1.1. Kindertageseinrichtungen im
- Seite 454 und 455:
2.1.3. Kindertageseinrichtungen im
- Seite 456 und 457:
Schulte-Witten-Park Park und der Wo
- Seite 458 und 459:
2.2.2. Angebote der Kinder- und Jug
- Seite 460 und 461:
Jugendliche aus dem Sozialraum West
- Seite 462 und 463:
2.3. Spielplätze im Stadtbezirk In
- Seite 464 und 465:
2.4.4. 2.5. 2.5.1. Einschätzung de
- Seite 466 und 467:
Verein Angebot Öffnungszeiten Teil
- Seite 468 und 469:
Jugendkontaktbeamte der Polizei In
- Seite 470 und 471:
3.2. Jugendgerichtshilfe Bereiche /
- Seite 472 und 473:
4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. Bewertung der
- Seite 474 und 475:
Die vorhandenen Spielstraßen und v
- Seite 476 und 477:
der Realschule und des Gymnasiums i
- Seite 478 und 479:
4.3.4. Bewertung der Lebensbedingun
- Seite 480 und 481:
5.1.1.4. Vernetzung und intensiver
- Seite 482 und 483:
5.2.1.10. Schaffung und Erweiterung
- Seite 484 und 485:
5.3.1.7. Schaffung von Freizeitange
- Seite 486 und 487:
Seite 50
- Seite 488 und 489:
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
- Seite 491:
Inhaltsverzeichnis Bestandsaufnahme
- Seite 494 und 495:
Seite 6 Tabelle Anteile der Minderj
- Seite 496 und 497:
Seite 8 Tabelle Anteile der Kinder,
- Seite 498 und 499:
1.3.2. Arbeitslosenstatistik Der St
- Seite 500 und 501:
2. Bestand an Einrichtungen 2.1. Ki
- Seite 502 und 503:
2.1.1. Kindertageseinrichtungen im
- Seite 504 und 505:
Name der Einrichtung Sprachheilkind
- Seite 506 und 507:
2.2. Angebote der Kinder- und Jugen
- Seite 508 und 509:
2.2.3. Angebote der Kinder- und Jug
- Seite 510 und 511:
2.3. Spielplätze im Stadtbezirk Me
- Seite 512 und 513:
2.4.3. Angebote im Sozialraum Nette
- Seite 514 und 515:
2.5. Kinder- und Jugendfreizeitange
- Seite 516 und 517:
Die Arbeitsgemeinschaft Mengeder Fe
- Seite 518 und 519:
In der Beratungsstelle sind insgesa
- Seite 520 und 521:
3.2. Jugendgerichtshilfe Bereiche /
- Seite 522 und 523:
4.1.2. Bewertung der Lebensbedingun
- Seite 524 und 525:
direkt an der Stadtgrenze zu Huckar
- Seite 526 und 527:
ezeichnen. Kinder dieser Altersgrup
- Seite 528 und 529:
Für den Bereich Eugen Richterstr.
- Seite 530 und 531:
5.1.1.3. Deutsch- Sprachkurse für
- Seite 532 und 533:
5.2.1.6. Regelmäßige Pflege von G
- Seite 534 und 535:
Die Frage nach den möglichen Räum
- Seite 536 und 537:
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
- Seite 539:
Inhaltsverzeichnis Bestandsaufnahme
- Seite 542 und 543:
1.2.1. Altersstruktur Der Anteil de
- Seite 544 und 545:
1.2.2. Anteil von Kindern und Jugen
- Seite 546 und 547:
1.3. Materielle Situation Der Bezug
- Seite 548 und 549:
Jahre, die diese Leistung in Anspru
- Seite 550 und 551:
Bereiche / Sozialräume Kinderzahl
- Seite 552 und 553:
2.1.1. Kindertageseinrichtungen im
- Seite 554 und 555:
Name der Einrichtung Lummerland e.V
- Seite 556 und 557:
In der städtischen Einrichtung wie
- Seite 558 und 559:
2.2.5. Einschätzung der Angebotsst
- Seite 560 und 561:
2.3. Spielplätze im Stadtbezirk Ap
- Seite 562 und 563:
2.4. Angebote der Jugendhilfe in Ko
- Seite 564 und 565:
2.5.2. Freizeitangebote der Vereine
- Seite 566 und 567:
2.5.5. Einschätzung zur Angebotsst
- Seite 568 und 569:
Psychologische Beratungsstelle für
- Seite 570 und 571:
der Bereich der BSHG-Betreuungen
- Seite 572 und 573:
4. Aspekte zur Beschreibung der Leb
- Seite 574 und 575:
Zudem gibt es zentrale Aktionen fü
- Seite 576 und 577:
4.2. Bewertung im Sozialraum Bergho
- Seite 578 und 579:
Die aus Sicht der Sozialraumgruppe
- Seite 580 und 581:
4.3.2. Bewertung der Lebensbedingun
- Seite 582 und 583:
Neben kleineren Grünflächen durch
- Seite 584 und 585:
In den Bereichen Sölderholz und Li
- Seite 586 und 587:
5.1.2.3. Werbeveranstaltung „Bege
- Seite 588 und 589:
5.4.2. Bedarfsanmeldungen und Anfor
- Seite 590 und 591:
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
- Seite 593 und 594:
Vorbemerkung Unmittelbare soziale L
- Seite 595 und 596:
Sozialräumliche Jugendhilfeplanung
- Seite 597 und 598:
Die Projektbegleitgruppe hat kontin
- Seite 599 und 600:
Sozialräumliche Jugendhilfeplanung
- Seite 601 und 602:
Datenstruktur: Altersgruppen der ju
- Seite 603 und 604:
1.3. Materielle Situation Datenstru
- Seite 605 und 606:
2. Bestand an Einrichtungen In dem
- Seite 607 und 608:
Für jeden Planungsraum wurde die s
- Seite 609 und 610:
Sozialhilfedienst Die städtischen
- Seite 611 und 612:
Nach jetzigem Sachstand ist davon a
- Seite 613 und 614:
In einem zweiten Schritt wurden die
- Seite 615 und 616:
Dabei wurden folgende Eckpunkte fü
- Seite 617 und 618:
Arbeitsschwerpunkt: Qualifizierung