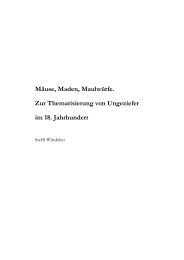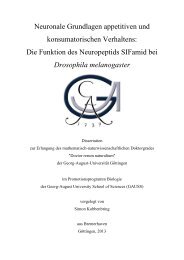- Seite 1 und 2:
Die Selbstmörderin als Tugendheldi
- Seite 3 und 4:
Bene mori est libenter mori Seneca
- Seite 5 und 6:
Inhaltsübersicht 3 Kleopatra: Tuge
- Seite 7 und 8:
Vorwort Vorwort Am Ausgangspunkt di
- Seite 9 und 10:
Vorwort nachtridentinische A n d a
- Seite 11 und 12:
Vorwort schreibung eines Bildtyps a
- Seite 13 und 14:
I ›Schönes Sterben‹ torste, ru
- Seite 15 und 16:
I ›Schönes Sterben‹ Schlüssel
- Seite 17 und 18:
I ›Schönes Sterben‹ mit seinen
- Seite 19 und 20:
I ›Schönes Sterben‹ Die ›ste
- Seite 21 und 22:
I ›Schönes Sterben‹ aus neue K
- Seite 23 und 24:
I ›Schönes Sterben‹ mourir en
- Seite 25 und 26:
I ›Schönes Sterben‹ Der Gattun
- Seite 27 und 28:
I ›Schönes Sterben‹ Der undiff
- Seite 29 und 30:
II Sterbebildtypen und Todesdarstel
- Seite 31 und 32:
II Sterbebildtypen und Todesdarstel
- Seite 33 und 34:
II Sterbebildtypen und Todesdarstel
- Seite 35 und 36:
II Sterbebildtypen und Todesdarstel
- Seite 37 und 38:
II Sterbebildtypen und Todesdarstel
- Seite 39 und 40:
II Sterbebildtypen und Todesdarstel
- Seite 41 und 42:
II Sterbebildtypen und Todesdarstel
- Seite 43 und 44:
II Sterbebildtypen und Todesdarstel
- Seite 45 und 46:
III Bildthemen exemplarischen Sterb
- Seite 47 und 48:
III Bildthemen exemplarischen Sterb
- Seite 49 und 50:
4 Sterbende Helden III Bildthemen e
- Seite 51 und 52:
III Bildthemen exemplarischen Sterb
- Seite 53 und 54:
III Bildthemen exemplarischen Sterb
- Seite 55 und 56:
III Bildthemen exemplarischen Sterb
- Seite 57 und 58:
IV Liebe, Patriotismus und Selbstbe
- Seite 59 und 60:
IV Liebe, Patriotismus und Selbstbe
- Seite 61 und 62:
IV Liebe, Patriotismus und Selbstbe
- Seite 63 und 64:
IV Liebe, Patriotismus und Selbstbe
- Seite 65 und 66:
IV Liebe, Patriotismus und Selbstbe
- Seite 67 und 68:
IV Liebe, Patriotismus und Selbstbe
- Seite 69 und 70:
IV Liebe, Patriotismus und Selbstbe
- Seite 71 und 72:
IV Liebe, Patriotismus und Selbstbe
- Seite 73 und 74:
IV Liebe, Patriotismus und Selbstbe
- Seite 75 und 76:
IV Liebe, Patriotismus und Selbstbe
- Seite 77 und 78:
IV Liebe, Patriotismus und Selbstbe
- Seite 79 und 80:
IV Liebe, Patriotismus und Selbstbe
- Seite 81 und 82:
IV Liebe, Patriotismus und Selbstbe
- Seite 83 und 84:
IV Liebe, Patriotismus und Selbstbe
- Seite 85 und 86:
IV Liebe, Patriotismus und Selbstbe
- Seite 87 und 88:
IV Liebe, Patriotismus und Selbstbe
- Seite 89 und 90:
IV Liebe, Patriotismus und Selbstbe
- Seite 91 und 92:
IV Liebe, Patriotismus und Selbstbe
- Seite 93 und 94:
IV Liebe, Patriotismus und Selbstbe
- Seite 95 und 96:
IV Liebe, Patriotismus und Selbstbe
- Seite 97 und 98:
IV Liebe, Patriotismus und Selbstbe
- Seite 99 und 100:
IV Liebe, Patriotismus und Selbstbe
- Seite 101 und 102:
IV Liebe, Patriotismus und Selbstbe
- Seite 103 und 104:
V Römische Tugendheldinnen in der
- Seite 105 und 106:
Dido: Herrscherin und Liebende zuti
- Seite 107 und 108:
Dido: Herrscherin und Liebende do,
- Seite 109 und 110:
Dido: Herrscherin und Liebende ein
- Seite 111 und 112:
Dido: Herrscherin und Liebende Die
- Seite 113 und 114:
Dido: Herrscherin und Liebende und
- Seite 115 und 116:
Dido: Herrscherin und Liebende (170
- Seite 117 und 118:
Turners (1775-1851) Dido building C
- Seite 119 und 120:
Lukretia: Keuschheit, eheliche Treu
- Seite 121 und 122:
Lukretia: Keuschheit, eheliche Treu
- Seite 123 und 124:
Lukretia: Keuschheit, eheliche Treu
- Seite 125 und 126:
Lukretia: Keuschheit, eheliche Treu
- Seite 127 und 128:
Lukretia: Keuschheit, eheliche Treu
- Seite 129 und 130:
gelöst. Beibehalten werden der ein
- Seite 131 und 132:
Lukretia: Keuschheit, eheliche Treu
- Seite 133 und 134:
Lukretia: Keuschheit, eheliche Treu
- Seite 135 und 136:
Lukretia: Keuschheit, eheliche Treu
- Seite 137 und 138:
Lukretia: Keuschheit, eheliche Treu
- Seite 139 und 140:
Kleopatra: Tugendheldin oder femme
- Seite 141 und 142:
Kleopatra: Tugendheldin oder femme
- Seite 143 und 144:
Kleopatra: Tugendheldin oder femme
- Seite 145 und 146:
Kleopatra: Tugendheldin oder femme
- Seite 147 und 148:
Kleopatra: Tugendheldin oder femme
- Seite 149 und 150:
Kleopatra: Tugendheldin oder femme
- Seite 151 und 152:
Kleopatra: Tugendheldin oder femme
- Seite 153 und 154:
Kleopatra: Tugendheldin oder femme
- Seite 155 und 156:
Tod Kleopatras sogar in beiden zur
- Seite 157 und 158:
Kleopatra: Tugendheldin oder femme
- Seite 159 und 160:
Kleopatra: Tugendheldin oder femme
- Seite 161 und 162:
Kleopatra: Tugendheldin oder femme
- Seite 163 und 164:
Kleopatra: Tugendheldin oder femme
- Seite 165 und 166:
Kleopatra: Tugendheldin oder femme
- Seite 167 und 168:
Porzia: Republikanerin, Ehefrau und
- Seite 169 und 170:
Porzia: Republikanerin, Ehefrau und
- Seite 171 und 172:
Porzia: Republikanerin, Ehefrau und
- Seite 173 und 174:
Porzia: Republikanerin, Ehefrau und
- Seite 175 und 176:
Porzia: Republikanerin, Ehefrau und
- Seite 177 und 178:
VI Der Neustoizismus: Leitphilosoph
- Seite 179 und 180:
VI Der Neustoizismus: Leitphilosoph
- Seite 181 und 182:
VI Der Neustoizismus: Leitphilosoph
- Seite 183 und 184:
VI Der Neustoizismus: Leitphilosoph
- Seite 185 und 186:
VI Der Neustoizismus: Leitphilosoph
- Seite 187 und 188:
VI Der Neustoizismus: Leitphilosoph
- Seite 189 und 190:
VI Der Neustoizismus: Leitphilosoph
- Seite 191 und 192:
VI Der Neustoizismus: Leitphilosoph
- Seite 193 und 194:
VI Der Neustoizismus: Leitphilosoph
- Seite 195 und 196:
VI Der Neustoizismus: Leitphilosoph
- Seite 197 und 198:
VI Der Neustoizismus: Leitphilosoph
- Seite 199 und 200:
VI Der Neustoizismus: Leitphilosoph
- Seite 201 und 202:
VI Der Neustoizismus: Leitphilosoph
- Seite 203 und 204:
VI Der Neustoizismus: Leitphilosoph
- Seite 205 und 206:
VII Posttridentinische Märtyrer un
- Seite 207 und 208:
VII Posttridentinische Märtyrer un
- Seite 209 und 210:
VII Posttridentinische Märtyrer un
- Seite 211 und 212: VII Posttridentinische Märtyrer un
- Seite 213 und 214: VII Posttridentinische Märtyrer un
- Seite 215 und 216: VII Posttridentinische Märtyrer un
- Seite 217 und 218: VII Posttridentinische Märtyrer un
- Seite 219 und 220: VII Posttridentinische Märtyrer un
- Seite 221 und 222: VII Posttridentinische Märtyrer un
- Seite 223 und 224: VII Posttridentinische Märtyrer un
- Seite 225 und 226: VII Posttridentinische Märtyrer un
- Seite 227 und 228: VII Posttridentinische Märtyrer un
- Seite 229 und 230: VII Posttridentinische Märtyrer un
- Seite 231 und 232: VII Posttridentinische Märtyrer un
- Seite 233 und 234: VIII Tema con variazioni - Bildprog
- Seite 235 und 236: VIII Tema con variazioni - Bildprog
- Seite 237 und 238: VIII Tema con variazioni - Bildprog
- Seite 239 und 240: VIII Tema con variazioni - Bildprog
- Seite 241 und 242: VIII Tema con variazioni - Bildprog
- Seite 243 und 244: VIII Tema con variazioni - Bildprog
- Seite 245 und 246: VIII Tema con variazioni - Bildprog
- Seite 247 und 248: VIII Tema con variazioni - Bildprog
- Seite 249 und 250: VIII Tema con variazioni - Bildprog
- Seite 251 und 252: VIII Tema con variazioni - Bildprog
- Seite 253 und 254: VIII Tema con variazioni - Bildprog
- Seite 255 und 256: VIII Tema con variazioni - Bildprog
- Seite 257 und 258: VIII Tema con variazioni - Bildprog
- Seite 259 und 260: VIII Tema con variazioni - Bildprog
- Seite 261: VIII Tema con variazioni - Bildprog
- Seite 265 und 266: VIII Tema con variazioni - Bildprog
- Seite 267 und 268: VIII Tema con variazioni - Bildprog
- Seite 269 und 270: VIII Tema con variazioni - Bildprog
- Seite 271 und 272: VIII Tema con variazioni - Bildprog
- Seite 273 und 274: IX Von der vertu zum Affekt Couperu
- Seite 275 und 276: IX Von der vertu zum Affekt eine er
- Seite 277 und 278: IX Von der vertu zum Affekt Cassand
- Seite 279 und 280: IX Von der vertu zum Affekt Didos;
- Seite 281 und 282: IX Von der vertu zum Affekt Diese U
- Seite 283 und 284: IX Von der vertu zum Affekt tutti c
- Seite 285 und 286: IX Von der vertu zum Affekt reits b
- Seite 287 und 288: IX Von der vertu zum Affekt greifen
- Seite 289 und 290: IX Von der vertu zum Affekt Der die
- Seite 291 und 292: IX Von der vertu zum Affekt dem sic
- Seite 293 und 294: IX Von der vertu zum Affekt Als Unt
- Seite 295 und 296: IX Von der vertu zum Affekt ἀλλ
- Seite 297 und 298: IX Von der vertu zum Affekt Die Ver
- Seite 299 und 300: IX Von der vertu zum Affekt öffent
- Seite 301 und 302: IX Von der vertu zum Affekt des Aff
- Seite 303 und 304: X Exempla virtutis zur frühneuzeit
- Seite 305 und 306: X Exempla virtutis heit der Textsor
- Seite 307 und 308: X Exempla virtutis Ebenso ambivalen
- Seite 309 und 310: X Exempla virtutis Umbesetzungen vo
- Seite 311 und 312: X Exempla virtutis vor: Bei Livius
- Seite 313 und 314:
X Exempla virtutis Die umstandslose
- Seite 315 und 316:
X Exempla virtutis Damit hat die Be
- Seite 317 und 318:
[Augsburg / Cleveland] [Amsterdam]
- Seite 319 und 320:
[Delft] [Dresden] Ausstellungskatal
- Seite 321 und 322:
[London] Ausstellungskataloge Walke
- Seite 323 und 324:
[Vaduz] Ausstellungskataloge Wieczo
- Seite 325 und 326:
[Berlin] [Biberach] Bestandskatalog
- Seite 327 und 328:
[London] [London] [Madrid] [Münche
- Seite 329 und 330:
[Wien] [Wien] Bestandskataloge Trne
- Seite 331 und 332:
Quellentexte [Boccaccio, Giovanni:]
- Seite 333 und 334:
Quellentexte [Humboldt] Foerst-Crat
- Seite 335 und 336:
Quellentexte Petrarca, Francesco: R
- Seite 337 und 338:
Forschungsliteratur Abel, Günter:
- Seite 339 und 340:
Forschungsliteratur Bassani Pacht,
- Seite 341 und 342:
Forschungsliteratur Bott, Katharina
- Seite 343 und 344:
Forschungsliteratur Cassani, Silvia
- Seite 345 und 346:
Forschungsliteratur Dubois, Isabell
- Seite 347 und 348:
Forschungsliteratur Frappier, Jean
- Seite 349 und 350:
Forschungsliteratur Grimm, Reinhold
- Seite 351 und 352:
Forschungsliteratur Herzog, Reinhar
- Seite 353 und 354:
Forschungsliteratur Jooss, Birgit:
- Seite 355 und 356:
Forschungsliteratur Koselleck, Rein
- Seite 357 und 358:
Forschungsliteratur Mahon, Denis (H
- Seite 359 und 360:
Forschungsliteratur Montagu, Jennif
- Seite 361 und 362:
Forschungsliteratur Petzold, Martin
- Seite 363 und 364:
Forschungsliteratur Rosa, Alberto A
- Seite 365 und 366:
Forschungsliteratur Schreiber, Ulri
- Seite 367 und 368:
Forschungsliteratur Stieger, Franz:
- Seite 369 und 370:
Forschungsliteratur Volkmann, Hans:
- Seite 371 und 372:
7 Ammann, Jost (1539-1591) Sophonis
- Seite 373 und 374:
22 Assereto, Gioacchino (1600-1649)
- Seite 375 und 376:
36 Blanchard, Jacques (1600-1638) 3
- Seite 377 und 378:
50 Bourdon, Sébastien (1616-1671)
- Seite 379 und 380:
65 Chauveau, François (1613-1676)
- Seite 381 und 382:
78 Crosato, Giovanni Bat- tista (16
- Seite 383 und 384:
92 de Peters, Johann Anton (1725-17
- Seite 385 und 386:
105 Dossi, Dosso (1486-1542) 106 Du
- Seite 387 und 388:
118 Elliger d. J., Ottmar (1666-173
- Seite 389 und 390:
132 Franz Caucig (1755-1828) 133 Fr
- Seite 391 und 392:
146 Gentileschi, Artemisia (1593-16
- Seite 393 und 394:
155 Giordano, Luca (1634-1705) 156
- Seite 395 und 396:
167 Guercino, Barbieri, Giovanni Fr
- Seite 397 und 398:
176 Hamilton, Gavin (1723-1797) 177
- Seite 399 und 400:
190 Kauffmann, Angelika (1741-1807)
- Seite 401 und 402:
202 Lairesse, Gérard de (1640-1711
- Seite 403 und 404:
216 Loth, Johann Carl (1632-1698) 2
- Seite 405 und 406:
231 Maratta, Carlo (1625-1713) 231a
- Seite 407 und 408:
245 Mignard, Pierre (1612-1695) (zu
- Seite 409 und 410:
258 Nattier, Jean-Baptiste (1678-17
- Seite 411 und 412:
271 Peyron, Jean François Pierre (
- Seite 413 und 414:
283 Preti, Mattia (1613-1699) 284 P
- Seite 415 und 416:
297 Raimondi, Marcantonio (um 1480
- Seite 417 und 418:
311 Reni, Guido (1575-1642) 312 Ren
- Seite 419 und 420:
328 Reni, Guido (1575-1642) 329 Ren
- Seite 421 und 422:
343 Ricci, Sebastiano (1659-1734) 3
- Seite 423 und 424:
357 Rubens, Peter Paul (1577-1640)
- Seite 425 und 426:
372 Sirani, Elisabetta (1638-1665)
- Seite 427 und 428:
385 Stanzione, Massimo (1585-1656)
- Seite 429 und 430:
398 Tischbein, Johann Hein- rich (1
- Seite 431 und 432:
408 Unbekannt Sterben des Antonius
- Seite 433 und 434:
422 Vignon, Claude (1593-1670) 423
- Seite 435 und 436:
Künstlerverzeichnis Aachen, Hans v
- Seite 437 und 438:
Gandolfi, Gaetano 132, 135 Genga, G
- Seite 439 und 440:
Perugino, Pietro 81 Pinelli, Bartol
- Seite 441 und 442:
Personen Abigaïl 253 Abraham 256 A
- Seite 443 und 444:
Borghese, Scipione 213 Boroni, Anto
- Seite 445 und 446:
Delamont, Francois Collin 287 Delfi
- Seite 447 und 448:
Händel, Georg Friedrich 143, 278,
- Seite 449 und 450:
Karl VI. 26 Kassandra 297 Katharina
- Seite 451 und 452:
Meilleraye, Duchesse de La 252, 257
- Seite 453 und 454:
Pollarol, Antonio 123 Polyxena 238,
- Seite 455 und 456:
Serre, Jean Puget de la 255 Shaftes
- Seite 457 und 458:
Zesen, Philipp von 75, 336 Zeuxis 2
- Seite 459 und 460:
Forschung Baumgärtel, Bettina 23,
- Seite 461 und 462:
Daxelmüller, Christoph 28, 305 de
- Seite 463 und 464:
Gomille, M. 261 Göpfert, Herbert 3
- Seite 465 und 466:
Kirchner, Thomas 90 Klein, Dorothee
- Seite 467 und 468:
Ost, Hans 130 Osthoff, Wolfgang 276
- Seite 469 und 470:
Schmidt, Peter Lebrecht 53 Schmidt,
- Seite 471:
Trnek, Renate 52 Tuck, Richard 185