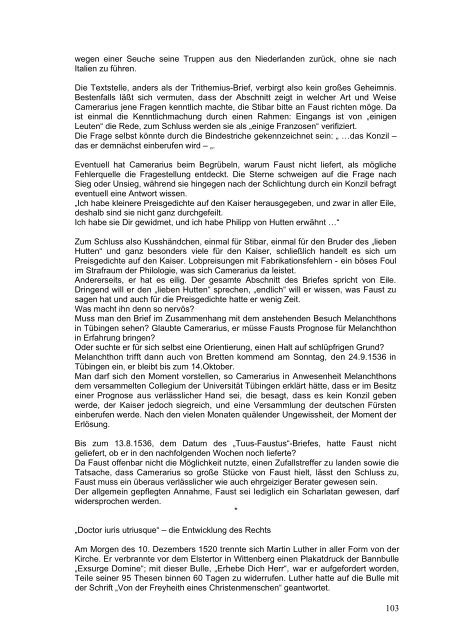Faust im Visier des Geheimdienstes (PDF) Neufassung
Faust im Visier des Geheimdienstes (PDF) Neufassung
Faust im Visier des Geheimdienstes (PDF) Neufassung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
wegen einer Seuche seine Truppen aus den Niederlanden zurück, ohne sie nach<br />
Italien zu führen.<br />
Die Textstelle, anders als der Trithemius-Brief, verbirgt also kein großes Gehe<strong>im</strong>nis.<br />
Bestenfalls läßt sich vermuten, dass der Abschnitt zeigt in welcher Art und Weise<br />
Camerarius jene Fragen kenntlich machte, die Stibar bitte an <strong>Faust</strong> richten möge. Da<br />
ist einmal die Kenntlichmachung durch einen Rahmen: Eingangs ist von „einigen<br />
Leuten“ die Rede, zum Schluss werden sie als „einige Franzosen“ verifiziert.<br />
Die Frage selbst könnte durch die Bin<strong>des</strong>triche gekennzeichnet sein: „ …das Konzil –<br />
das er demnächst einberufen wird – „.<br />
Eventuell hat Camerarius be<strong>im</strong> Begrübeln, warum <strong>Faust</strong> nicht liefert, als mögliche<br />
Fehlerquelle die Fragestellung entdeckt. Die Sterne schweigen auf die Frage nach<br />
Sieg oder Unsieg, während sie hingegen nach der Schlichtung durch ein Konzil befragt<br />
eventuell eine Antwort wissen.<br />
„Ich habe kleinere Preisgedichte auf den Kaiser herausgegeben, und zwar in aller Eile,<br />
<strong>des</strong>halb sind sie nicht ganz durchgefeilt.<br />
Ich habe sie Dir gewidmet, und ich habe Philipp von Hutten erwähnt …“<br />
Zum Schluss also Kusshändchen, einmal für Stibar, einmal für den Bruder <strong>des</strong> „lieben<br />
Hutten“ und ganz besonders viele für den Kaiser, schließlich handelt es sich um<br />
Preisgedichte auf den Kaiser. Lobpreisungen mit Fabrikationsfehlern - ein böses Foul<br />
<strong>im</strong> Strafraum der Philologie, was sich Camerarius da leistet.<br />
Andererseits, er hat es eilig. Der gesamte Abschnitt <strong>des</strong> Briefes spricht von Eile.<br />
Dringend will er den „lieben Hutten“ sprechen, „endlich“ will er wissen, was <strong>Faust</strong> zu<br />
sagen hat und auch für die Preisgedichte hatte er wenig Zeit.<br />
Was macht ihn denn so nervös?<br />
Muss man den Brief <strong>im</strong> Zusammenhang mit dem anstehenden Besuch Melanchthons<br />
in Tübingen sehen? Glaubte Camerarius, er müsse <strong>Faust</strong>s Prognose für Melanchthon<br />
in Erfahrung bringen?<br />
Oder suchte er für sich selbst eine Orientierung, einen Halt auf schlüpfrigen Grund?<br />
Melanchthon trifft dann auch von Bretten kommend am Sonntag, den 24.9.1536 in<br />
Tübingen ein, er bleibt bis zum 14.Oktober.<br />
Man darf sich den Moment vorstellen, so Camerarius in Anwesenheit Melanchthons<br />
dem versammelten Collegium der Universität Tübingen erklärt hätte, dass er <strong>im</strong> Besitz<br />
einer Prognose aus verlässlicher Hand sei, die besagt, dass es kein Konzil geben<br />
werde, der Kaiser jedoch siegreich, und eine Versammlung der deutschen Fürsten<br />
einberufen werde. Nach den vielen Monaten quälender Ungewissheit, der Moment der<br />
Erlösung.<br />
Bis zum 13.8.1536, dem Datum <strong>des</strong> „Tuus-<strong>Faust</strong>us“-Briefes, hatte <strong>Faust</strong> nicht<br />
geliefert, ob er in den nachfolgenden Wochen noch lieferte?<br />
Da <strong>Faust</strong> offenbar nicht die Möglichkeit nutzte, einen Zufallstreffer zu landen sowie die<br />
Tatsache, dass Camerarius so große Stücke von <strong>Faust</strong> hielt, lässt den Schluss zu,<br />
<strong>Faust</strong> muss ein überaus verlässlicher wie auch ehrgeiziger Berater gewesen sein.<br />
Der allgemein gepflegten Annahme, <strong>Faust</strong> sei lediglich ein Scharlatan gewesen, darf<br />
widersprochen werden.<br />
*<br />
„Doctor iuris utriusque“ – die Entwicklung <strong>des</strong> Rechts<br />
Am Morgen <strong>des</strong> 10. Dezembers 1520 trennte sich Martin Luther in aller Form von der<br />
Kirche. Er verbrannte vor dem Elstertor in Wittenberg einen Plakatdruck der Bannbulle<br />
„Exsurge Domine“; mit dieser Bulle, „Erhebe Dich Herr“, war er aufgefordert worden,<br />
Teile seiner 95 Thesen binnen 60 Tagen zu widerrufen. Luther hatte auf die Bulle mit<br />
der Schrift „Von der Freyheith eines Christenmenschen“ geantwortet.<br />
103