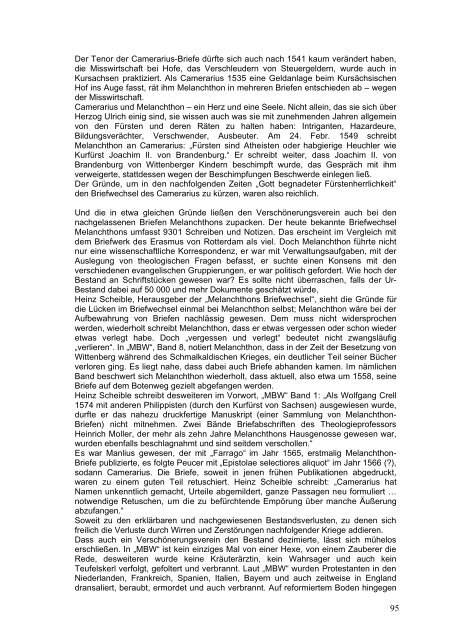Faust im Visier des Geheimdienstes (PDF) Neufassung
Faust im Visier des Geheimdienstes (PDF) Neufassung
Faust im Visier des Geheimdienstes (PDF) Neufassung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Der Tenor der Camerarius-Briefe dürfte sich auch nach 1541 kaum verändert haben,<br />
die Misswirtschaft bei Hofe, das Verschleudern von Steuergeldern, wurde auch in<br />
Kursachsen praktiziert. Als Camerarius 1535 eine Geldanlage be<strong>im</strong> Kursächsischen<br />
Hof ins Auge fasst, rät ihm Melanchthon in mehreren Briefen entschieden ab – wegen<br />
der Misswirtschaft.<br />
Camerarius und Melanchthon – ein Herz und eine Seele. Nicht allein, das sie sich über<br />
Herzog Ulrich einig sind, sie wissen auch was sie mit zunehmenden Jahren allgemein<br />
von den Fürsten und deren Räten zu halten haben: Intriganten, Hazardeure,<br />
Bildungsverächter, Verschwender, Ausbeuter. Am 24. Febr. 1549 schreibt<br />
Melanchthon an Camerarius: „Fürsten sind Atheisten oder habgierige Heuchler wie<br />
Kurfürst Joach<strong>im</strong> II. von Brandenburg.“ Er schreibt weiter, dass Joach<strong>im</strong> II. von<br />
Brandenburg von Wittenberger Kindern besch<strong>im</strong>pft wurde, das Gespräch mit ihm<br />
verweigerte, statt<strong>des</strong>sen wegen der Besch<strong>im</strong>pfungen Beschwerde einlegen ließ.<br />
Der Gründe, um in den nachfolgenden Zeiten „Gott begnadeter Fürstenherrlichkeit“<br />
den Briefwechsel <strong>des</strong> Camerarius zu kürzen, waren also reichlich.<br />
Und die in etwa gleichen Gründe ließen den Verschönerungsverein auch bei den<br />
nachgelassenen Briefen Melanchthons zupacken. Der heute bekannte Briefwechsel<br />
Melanchthons umfasst 9301 Schreiben und Notizen. Das erscheint <strong>im</strong> Vergleich mit<br />
dem Briefwerk <strong>des</strong> Erasmus von Rotterdam als viel. Doch Melanchthon führte nicht<br />
nur eine wissenschaftliche Korrespondenz, er war mit Verwaltungsaufgaben, mit der<br />
Auslegung von theologischen Fragen befasst, er suchte einen Konsens mit den<br />
verschiedenen evangelischen Gruppierungen, er war politisch gefordert. Wie hoch der<br />
Bestand an Schriftstücken gewesen war? Es sollte nicht überraschen, falls der Ur-<br />
Bestand dabei auf 50 000 und mehr Dokumente geschätzt würde,<br />
Heinz Scheible, Herausgeber der „Melanchthons Briefwechsel“, sieht die Gründe für<br />
die Lücken <strong>im</strong> Briefwechsel einmal bei Melanchthon selbst; Melanchthon wäre bei der<br />
Aufbewahrung von Briefen nachlässig gewesen. Dem muss nicht widersprochen<br />
werden, wiederholt schreibt Melanchthon, dass er etwas vergessen oder schon wieder<br />
etwas verlegt habe. Doch „vergessen und verlegt“ bedeutet nicht zwangsläufig<br />
„verlieren“. In „MBW“, Band 8, notiert Melanchthon, dass in der Zeit der Besetzung von<br />
Wittenberg während <strong>des</strong> Schmalkaldischen Krieges, ein deutlicher Teil seiner Bücher<br />
verloren ging. Es liegt nahe, dass dabei auch Briefe abhanden kamen. Im nämlichen<br />
Band beschwert sich Melanchthon wiederholt, dass aktuell, also etwa um 1558, seine<br />
Briefe auf dem Botenweg gezielt abgefangen werden.<br />
Heinz Scheible schreibt <strong>des</strong>weiteren <strong>im</strong> Vorwort, „MBW“ Band 1: „Als Wolfgang Crell<br />
1574 mit anderen Philippisten (durch den Kurfürst von Sachsen) ausgewiesen wurde,<br />
durfte er das nahezu druckfertige Manuskript (einer Sammlung von Melanchthon-<br />
Briefen) nicht mitnehmen. Zwei Bände Briefabschriften <strong>des</strong> Theologieprofessors<br />
Heinrich Moller, der mehr als zehn Jahre Melanchthons Hausgenosse gewesen war,<br />
wurden ebenfalls beschlagnahmt und sind seitdem verschollen.“<br />
Es war Manlius gewesen, der mit „Farrago“ <strong>im</strong> Jahr 1565, erstmalig Melanchthon-<br />
Briefe publizierte, es folgte Peucer mit „Epistolae selectiores aliquot“ <strong>im</strong> Jahr 1566 (?),<br />
sodann Camerarius. Die Briefe, soweit in jenen frühen Publikationen abgedruckt,<br />
waren zu einem guten Teil retuschiert. Heinz Scheible schreibt: „Camerarius hat<br />
Namen unkenntlich gemacht, Urteile abgemildert, ganze Passagen neu formuliert …<br />
notwendige Retuschen, um die zu befürchtende Empörung über manche Äußerung<br />
abzufangen.“<br />
Soweit zu den erklärbaren und nachgewiesenen Bestandsverlusten, zu denen sich<br />
freilich die Verluste durch Wirren und Zerstörungen nachfolgender Kriege addieren.<br />
Dass auch ein Verschönerungsverein den Bestand dez<strong>im</strong>ierte, lässt sich mühelos<br />
erschließen. In „MBW“ ist kein einziges Mal von einer Hexe, von einem Zauberer die<br />
Rede, <strong>des</strong>weiteren wurde keine Kräuterärztin, kein Wahrsager und auch kein<br />
Teufelskerl verfolgt, gefoltert und verbrannt. Laut „MBW“ wurden Protestanten in den<br />
Niederlanden, Frankreich, Spanien, Italien, Bayern und auch zeitweise in England<br />
dransaliert, beraubt, ermordet und auch verbrannt. Auf reformiertem Boden hingegen<br />
95