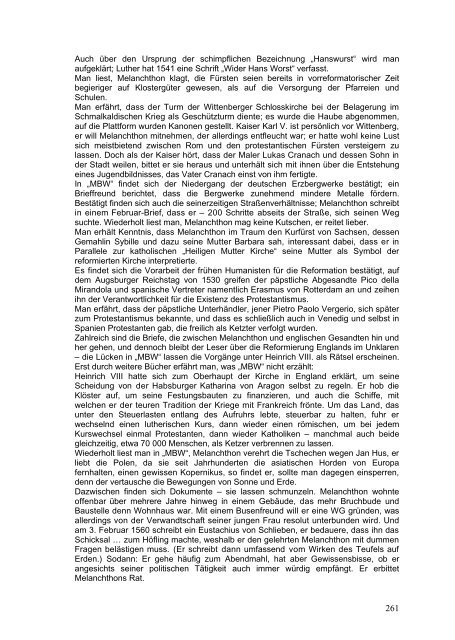Faust im Visier des Geheimdienstes (PDF) Neufassung
Faust im Visier des Geheimdienstes (PDF) Neufassung
Faust im Visier des Geheimdienstes (PDF) Neufassung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Auch über den Ursprung der sch<strong>im</strong>pflichen Bezeichnung „Hanswurst“ wird man<br />
aufgeklärt; Luther hat 1541 eine Schrift „Wider Hans Worst“ verfasst.<br />
Man liest, Melanchthon klagt, die Fürsten seien bereits in vorreformatorischer Zeit<br />
begieriger auf Klostergüter gewesen, als auf die Versorgung der Pfarreien und<br />
Schulen.<br />
Man erfährt, dass der Turm der Wittenberger Schlosskirche bei der Belagerung <strong>im</strong><br />
Schmalkaldischen Krieg als Geschützturm diente; es wurde die Haube abgenommen,<br />
auf die Plattform wurden Kanonen gestellt. Kaiser Karl V. ist persönlich vor Wittenberg,<br />
er will Melanchthon mitnehmen, der allerdings entfleucht war; er hatte wohl keine Lust<br />
sich meistbietend zwischen Rom und den protestantischen Fürsten versteigern zu<br />
lassen. Doch als der Kaiser hört, dass der Maler Lukas Cranach und <strong>des</strong>sen Sohn in<br />
der Stadt weilen, bittet er sie heraus und unterhält sich mit ihnen über die Entstehung<br />
eines Jugendbildnisses, das Vater Cranach einst von ihm fertigte.<br />
In „MBW“ findet sich der Niedergang der deutschen Erzbergwerke bestätigt; ein<br />
Brieffreund berichtet, dass die Bergwerke zunehmend mindere Metalle fördern.<br />
Bestätigt finden sich auch die seinerzeitigen Straßenverhältnisse; Melanchthon schreibt<br />
in einem Februar-Brief, dass er – 200 Schritte abseits der Straße, sich seinen Weg<br />
suchte. Wiederholt liest man, Melanchthon mag keine Kutschen, er reitet lieber.<br />
Man erhält Kenntnis, dass Melanchthon <strong>im</strong> Traum den Kurfürst von Sachsen, <strong>des</strong>sen<br />
Gemahlin Sybille und dazu seine Mutter Barbara sah, interessant dabei, dass er in<br />
Parallele zur katholischen „Heiligen Mutter Kirche“ seine Mutter als Symbol der<br />
reformierten Kirche interpretierte.<br />
Es findet sich die Vorarbeit der frühen Humanisten für die Reformation bestätigt, auf<br />
dem Augsburger Reichstag von 1530 greifen der päpstliche Abgesandte Pico della<br />
Mirandola und spanische Vertreter namentlich Erasmus von Rotterdam an und zeihen<br />
ihn der Verantwortlichkeit für die Existenz <strong>des</strong> Protestantismus.<br />
Man erfährt, dass der päpstliche Unterhändler, jener Pietro Paolo Vergerio, sich später<br />
zum Protestantismus bekannte, und dass es schließlich auch in Venedig und selbst in<br />
Spanien Protestanten gab, die freilich als Ketzter verfolgt wurden.<br />
Zahlreich sind die Briefe, die zwischen Melanchthon und englischen Gesandten hin und<br />
her gehen, und dennoch bleibt der Leser über die Reformierung Englands <strong>im</strong> Unklaren<br />
– die Lücken in „MBW“ lassen die Vorgänge unter Heinrich VIII. als Rätsel erscheinen.<br />
Erst durch weitere Bücher erfährt man, was „MBW“ nicht erzählt:<br />
Heinrich VIII hatte sich zum Oberhaupt der Kirche in England erklärt, um seine<br />
Scheidung von der Habsburger Katharina von Aragon selbst zu regeln. Er hob die<br />
Klöster auf, um seine Festungsbauten zu finanzieren, und auch die Schiffe, mit<br />
welchen er der teuren Tradition der Kriege mit Frankreich frönte. Um das Land, das<br />
unter den Steuerlasten entlang <strong>des</strong> Aufruhrs lebte, steuerbar zu halten, fuhr er<br />
wechselnd einen lutherischen Kurs, dann wieder einen römischen, um bei jedem<br />
Kurswechsel einmal Protestanten, dann wieder Katholiken – manchmal auch beide<br />
gleichzeitig, etwa 70 000 Menschen, als Ketzer verbrennen zu lassen.<br />
Wiederholt liest man in „MBW“, Melanchthon verehrt die Tschechen wegen Jan Hus, er<br />
liebt die Polen, da sie seit Jahrhunderten die asiatischen Horden von Europa<br />
fernhalten, einen gewissen Kopernikus, so findet er, sollte man dagegen einsperren,<br />
denn der vertausche die Bewegungen von Sonne und Erde.<br />
Dazwischen finden sich Dokumente – sie lassen schmunzeln. Melanchthon wohnte<br />
offenbar über mehrere Jahre hinweg in einem Gebäude, das mehr Bruchbude und<br />
Baustelle denn Wohnhaus war. Mit einem Busenfreund will er eine WG gründen, was<br />
allerdings von der Verwandtschaft seiner jungen Frau resolut unterbunden wird. Und<br />
am 3. Februar 1560 schreibt ein Eustachius von Schlieben, er bedauere, dass ihn das<br />
Schicksal … zum Höfling machte, weshalb er den gelehrten Melanchthon mit dummen<br />
Fragen belästigen muss. (Er schreibt dann umfassend vom Wirken <strong>des</strong> Teufels auf<br />
Erden.) Sodann: Er gehe häufig zum Abendmahl, hat aber Gewissensbisse, ob er<br />
angesichts seiner politischen Tätigkeit auch <strong>im</strong>mer würdig empfängt. Er erbittet<br />
Melanchthons Rat.<br />
261