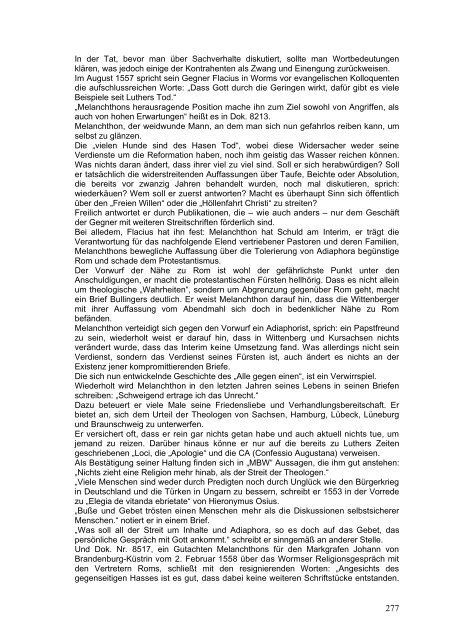Faust im Visier des Geheimdienstes (PDF) Neufassung
Faust im Visier des Geheimdienstes (PDF) Neufassung
Faust im Visier des Geheimdienstes (PDF) Neufassung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
In der Tat, bevor man über Sachverhalte diskutiert, sollte man Wortbedeutungen<br />
klären, was jedoch einige der Kontrahenten als Zwang und Einengung zurückweisen.<br />
Im August 1557 spricht sein Gegner Flacius in Worms vor evangelischen Kolloquenten<br />
die aufschlussreichen Worte: „Dass Gott durch die Geringen wirkt, dafür gibt es viele<br />
Beispiele seit Luthers Tod.“<br />
„Melanchthons herausragende Position mache ihn zum Ziel sowohl von Angriffen, als<br />
auch von hohen Erwartungen“ heißt es in Dok. 8213.<br />
Melanchthon, der weidwunde Mann, an dem man sich nun gefahrlos reiben kann, um<br />
selbst zu glänzen.<br />
Die „vielen Hunde sind <strong>des</strong> Hasen Tod“, wobei diese Widersacher weder seine<br />
Verdienste um die Reformation haben, noch ihm geistig das Wasser reichen können.<br />
Was nichts daran ändert, dass ihrer viel zu viel sind. Soll er sich herabwürdigen? Soll<br />
er tatsächlich die widerstreitenden Auffassungen über Taufe, Beichte oder Absolution,<br />
die bereits vor zwanzig Jahren behandelt wurden, noch mal diskutieren, sprich:<br />
wiederkäuen? Wem soll er zuerst antworten? Macht es überhaupt Sinn sich öffentlich<br />
über den „Freien Willen“ oder die „Höllenfahrt Christi“ zu streiten?<br />
Freilich antwortet er durch Publikationen, die – wie auch anders – nur dem Geschäft<br />
der Gegner mit weiteren Streitschriften förderlich sind.<br />
Bei alledem, Flacius hat ihn fest: Melanchthon hat Schuld am Inter<strong>im</strong>, er trägt die<br />
Verantwortung für das nachfolgende Elend vertriebener Pastoren und deren Familien,<br />
Melanchthons bewegliche Auffassung über die Tolerierung von Adiaphora begünstige<br />
Rom und schade dem Protestantismus.<br />
Der Vorwurf der Nähe zu Rom ist wohl der gefährlichste Punkt unter den<br />
Anschuldigungen, er macht die protestantischen Fürsten hellhörig. Dass es nicht allein<br />
um theologische „Wahrheiten“, sondern um Abgrenzung gegenüber Rom geht, macht<br />
ein Brief Bullingers deutlich. Er weist Melanchthon darauf hin, dass die Wittenberger<br />
mit ihrer Auffassung vom Abendmahl sich doch in bedenklicher Nähe zu Rom<br />
befänden.<br />
Melanchthon verteidigt sich gegen den Vorwurf ein Adiaphorist, sprich: ein Papstfreund<br />
zu sein, wiederholt weist er darauf hin, dass in Wittenberg und Kursachsen nichts<br />
verändert wurde, dass das Inter<strong>im</strong> keine Umsetzung fand. Was allerdings nicht sein<br />
Verdienst, sondern das Verdienst seines Fürsten ist, auch ändert es nichts an der<br />
Existenz jener kompromittierenden Briefe.<br />
Die sich nun entwickelnde Geschichte <strong>des</strong> „Alle gegen einen“, ist ein Verwirrspiel.<br />
Wiederholt wird Melanchthon in den letzten Jahren seines Lebens in seinen Briefen<br />
schreiben: „Schweigend ertrage ich das Unrecht.“<br />
Dazu beteuert er viele Male seine Friedensliebe und Verhandlungsbereitschaft. Er<br />
bietet an, sich dem Urteil der Theologen von Sachsen, Hamburg, Lübeck, Lüneburg<br />
und Braunschweig zu unterwerfen.<br />
Er versichert oft, dass er rein gar nichts getan habe und auch aktuell nichts tue, um<br />
jemand zu reizen. Darüber hinaus könne er nur auf die bereits zu Luthers Zeiten<br />
geschriebenen „Loci, die „Apologie“ und die CA (Confessio Augustana) verweisen.<br />
Als Bestätigung seiner Haltung finden sich in „MBW“ Aussagen, die ihm gut anstehen:<br />
„Nichts zieht eine Religion mehr hinab, als der Streit der Theologen.“<br />
„Viele Menschen sind weder durch Predigten noch durch Unglück wie den Bürgerkrieg<br />
in Deutschland und die Türken in Ungarn zu bessern, schreibt er 1553 in der Vorrede<br />
zu „Elegia de vitanda ebrietate“ von Hieronymus Osius.<br />
„Buße und Gebet trösten einen Menschen mehr als die Diskussionen selbstsicherer<br />
Menschen.“ notiert er in einem Brief.<br />
„Was soll all der Streit um Inhalte und Adiaphora, so es doch auf das Gebet, das<br />
persönliche Gespräch mit Gott ankommt.“ schreibt er sinngemäß an anderer Stelle.<br />
Und Dok. Nr. 8517, ein Gutachten Melanchthons für den Markgrafen Johann von<br />
Brandenburg-Küstrin vom 2. Februar 1558 über das Wormser Religionsgespräch mit<br />
den Vertretern Roms, schließt mit den resignierenden Worten: „Angesichts <strong>des</strong><br />
gegenseitigen Hasses ist es gut, dass dabei keine weiteren Schriftstücke entstanden.<br />
277