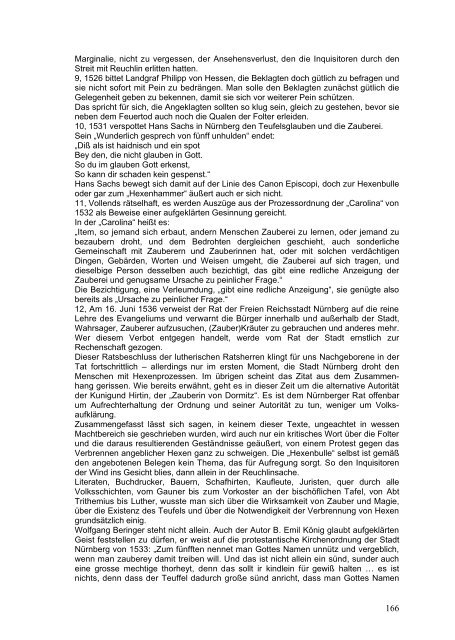Faust im Visier des Geheimdienstes (PDF) Neufassung
Faust im Visier des Geheimdienstes (PDF) Neufassung
Faust im Visier des Geheimdienstes (PDF) Neufassung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Marginalie, nicht zu vergessen, der Ansehensverlust, den die Inquisitoren durch den<br />
Streit mit Reuchlin erlitten hatten.<br />
9, 1526 bittet Landgraf Philipp von Hessen, die Beklagten doch gütlich zu befragen und<br />
sie nicht sofort mit Pein zu bedrängen. Man solle den Beklagten zunächst gütlich die<br />
Gelegenheit geben zu bekennen, damit sie sich vor weiterer Pein schützen.<br />
Das spricht für sich, die Angeklagten sollten so klug sein, gleich zu gestehen, bevor sie<br />
neben dem Feuertod auch noch die Qualen der Folter erleiden.<br />
10, 1531 verspottet Hans Sachs in Nürnberg den Teufelsglauben und die Zauberei.<br />
Sein „Wunderlich gesprech von fünff unhulden“ endet:<br />
„Diß als ist haidnisch und ein spot<br />
Bey den, die nicht glauben in Gott.<br />
So du <strong>im</strong> glauben Gott erkenst,<br />
So kann dir schaden kein gespenst.“<br />
Hans Sachs bewegt sich damit auf der Linie <strong>des</strong> Canon Episcopi, doch zur Hexenbulle<br />
oder gar zum „Hexenhammer“ äußert auch er sich nicht.<br />
11, Vollends rätselhaft, es werden Auszüge aus der Prozessordnung der „Carolina“ von<br />
1532 als Beweise einer aufgeklärten Gesinnung gereicht.<br />
In der „Carolina“ heißt es:<br />
„Item, so jemand sich erbaut, andern Menschen Zauberei zu lernen, oder jemand zu<br />
bezaubern droht, und dem Bedrohten dergleichen geschieht, auch sonderliche<br />
Gemeinschaft mit Zauberern und Zauberinnen hat, oder mit solchen verdächtigen<br />
Dingen, Gebärden, Worten und Weisen umgeht, die Zauberei auf sich tragen, und<br />
dieselbige Person <strong>des</strong>selben auch bezichtigt, das gibt eine redliche Anzeigung der<br />
Zauberei und genugsame Ursache zu peinlicher Frage.“<br />
Die Bezichtigung, eine Verleumdung, „gibt eine redliche Anzeigung“, sie genügte also<br />
bereits als „Ursache zu peinlicher Frage.“<br />
12, Am 16. Juni 1536 verweist der Rat der Freien Reichsstadt Nürnberg auf die reine<br />
Lehre <strong>des</strong> Evangeliums und verwarnt die Bürger innerhalb und außerhalb der Stadt,<br />
Wahrsager, Zauberer aufzusuchen, (Zauber)Kräuter zu gebrauchen und anderes mehr.<br />
Wer diesem Verbot entgegen handelt, werde vom Rat der Stadt ernstlich zur<br />
Rechenschaft gezogen.<br />
Dieser Ratsbeschluss der lutherischen Ratsherren klingt für uns Nachgeborene in der<br />
Tat fortschrittlich – allerdings nur <strong>im</strong> ersten Moment, die Stadt Nürnberg droht den<br />
Menschen mit Hexenprozessen. Im übrigen scheint das Zitat aus dem Zusammenhang<br />
gerissen. Wie bereits erwähnt, geht es in dieser Zeit um die alternative Autorität<br />
der Kunigund Hirtin, der „Zauberin von Dormitz“. Es ist dem Nürnberger Rat offenbar<br />
um Aufrechterhaltung der Ordnung und seiner Autorität zu tun, weniger um Volksaufklärung.<br />
Zusammengefasst lässt sich sagen, in keinem dieser Texte, ungeachtet in wessen<br />
Machtbereich sie geschrieben wurden, wird auch nur ein kritisches Wort über die Folter<br />
und die daraus resultierenden Geständnisse geäußert, von einem Protest gegen das<br />
Verbrennen angeblicher Hexen ganz zu schweigen. Die „Hexenbulle“ selbst ist gemäß<br />
den angebotenen Belegen kein Thema, das für Aufregung sorgt. So den Inquisitoren<br />
der Wind ins Gesicht blies, dann allein in der Reuchlinsache.<br />
Literaten, Buchdrucker, Bauern, Schafhirten, Kaufleute, Juristen, quer durch alle<br />
Volksschichten, vom Gauner bis zum Vorkoster an der bischöflichen Tafel, von Abt<br />
Trithemius bis Luther, wusste man sich über die Wirksamkeit von Zauber und Magie,<br />
über die Existenz <strong>des</strong> Teufels und über die Notwendigkeit der Verbrennung von Hexen<br />
grundsätzlich einig.<br />
Wolfgang Beringer steht nicht allein. Auch der Autor B. Emil König glaubt aufgeklärten<br />
Geist feststellen zu dürfen, er weist auf die protestantische Kirchenordnung der Stadt<br />
Nürnberg von 1533: „Zum fünfften nennet man Gottes Namen unnütz und vergeblich,<br />
wenn man zauberey damit treiben will. Und das ist nicht allein ein sünd, sunder auch<br />
eine grosse mechtige thorheyt, denn das sollt ir kindlein für gewiß halten … es ist<br />
nichts, denn dass der Teuffel dadurch große sünd anricht, dass man Gottes Namen<br />
166