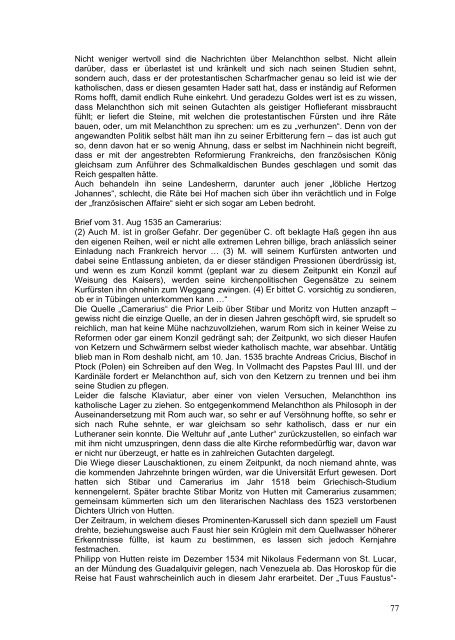Faust im Visier des Geheimdienstes (PDF) Neufassung
Faust im Visier des Geheimdienstes (PDF) Neufassung
Faust im Visier des Geheimdienstes (PDF) Neufassung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Nicht weniger wertvoll sind die Nachrichten über Melanchthon selbst. Nicht allein<br />
darüber, dass er überlastet ist und kränkelt und sich nach seinen Studien sehnt,<br />
sondern auch, dass er der protestantischen Scharfmacher genau so leid ist wie der<br />
katholischen, dass er diesen gesamten Hader satt hat, dass er inständig auf Reformen<br />
Roms hofft, damit endlich Ruhe einkehrt. Und geradezu Gol<strong>des</strong> wert ist es zu wissen,<br />
dass Melanchthon sich mit seinen Gutachten als geistiger Hoflieferant missbraucht<br />
fühlt; er liefert die Steine, mit welchen die protestantischen Fürsten und ihre Räte<br />
bauen, oder, um mit Melanchthon zu sprechen: um es zu „verhunzen“. Denn von der<br />
angewandten Politik selbst hält man ihn zu seiner Erbitterung fern – das ist auch gut<br />
so, denn davon hat er so wenig Ahnung, dass er selbst <strong>im</strong> Nachhinein nicht begreift,<br />
dass er mit der angestrebten Reformierung Frankreichs, den französischen König<br />
gleichsam zum Anführer <strong>des</strong> Schmalkaldischen Bun<strong>des</strong> geschlagen und somit das<br />
Reich gespalten hätte.<br />
Auch behandeln ihn seine Lan<strong>des</strong>herrn, darunter auch jener „löbliche Hertzog<br />
Johannes“, schlecht, die Räte bei Hof machen sich über ihn verächtlich und in Folge<br />
der „französischen Affaire“ sieht er sich sogar am Leben bedroht.<br />
Brief vom 31. Aug 1535 an Camerarius:<br />
(2) Auch M. ist in großer Gefahr. Der gegenüber C. oft beklagte Haß gegen ihn aus<br />
den eigenen Reihen, weil er nicht alle extremen Lehren billige, brach anlässlich seiner<br />
Einladung nach Frankreich hervor … (3) M. will seinem Kurfürsten antworten und<br />
dabei seine Entlassung anbieten, da er dieser ständigen Pressionen überdrüssig ist,<br />
und wenn es zum Konzil kommt (geplant war zu diesem Zeitpunkt ein Konzil auf<br />
Weisung <strong>des</strong> Kaisers), werden seine kirchenpolitischen Gegensätze zu seinem<br />
Kurfürsten ihn ohnehin zum Weggang zwingen. (4) Er bittet C. vorsichtig zu sondieren,<br />
ob er in Tübingen unterkommen kann …“<br />
Die Quelle „Camerarius“ die Prior Leib über Stibar und Moritz von Hutten anzapft –<br />
gewiss nicht die einzige Quelle, an der in diesen Jahren geschöpft wird, sie sprudelt so<br />
reichlich, man hat keine Mühe nachzuvollziehen, warum Rom sich in keiner Weise zu<br />
Reformen oder gar einem Konzil gedrängt sah; der Zeitpunkt, wo sich dieser Haufen<br />
von Ketzern und Schwärmern selbst wieder katholisch machte, war absehbar. Untätig<br />
blieb man in Rom <strong>des</strong>halb nicht, am 10. Jan. 1535 brachte Andreas Cricius, Bischof in<br />
Ptock (Polen) ein Schreiben auf den Weg. In Vollmacht <strong>des</strong> Papstes Paul III. und der<br />
Kardinäle fordert er Melanchthon auf, sich von den Ketzern zu trennen und bei ihm<br />
seine Studien zu pflegen.<br />
Leider die falsche Klaviatur, aber einer von vielen Versuchen, Melanchthon ins<br />
katholische Lager zu ziehen. So entgegenkommend Melanchthon als Philosoph in der<br />
Auseinandersetzung mit Rom auch war, so sehr er auf Versöhnung hoffte, so sehr er<br />
sich nach Ruhe sehnte, er war gleichsam so sehr katholisch, dass er nur ein<br />
Lutheraner sein konnte. Die Weltuhr auf „ante Luther“ zurückzustellen, so einfach war<br />
mit ihm nicht umzuspringen, denn dass die alte Kirche reformbedürftig war, davon war<br />
er nicht nur überzeugt, er hatte es in zahlreichen Gutachten dargelegt.<br />
Die Wiege dieser Lauschaktionen, zu einem Zeitpunkt, da noch niemand ahnte, was<br />
die kommenden Jahrzehnte bringen würden, war die Universität Erfurt gewesen. Dort<br />
hatten sich Stibar und Camerarius <strong>im</strong> Jahr 1518 be<strong>im</strong> Griechisch-Studium<br />
kennengelernt. Später brachte Stibar Moritz von Hutten mit Camerarius zusammen;<br />
gemeinsam kümmerten sich um den literarischen Nachlass <strong>des</strong> 1523 verstorbenen<br />
Dichters Ulrich von Hutten.<br />
Der Zeitraum, in welchem dieses Prominenten-Karussell sich dann speziell um <strong>Faust</strong><br />
drehte, beziehungsweise auch <strong>Faust</strong> hier sein Krüglein mit dem Quellwasser höherer<br />
Erkenntnisse füllte, ist kaum zu best<strong>im</strong>men, es lassen sich jedoch Kernjahre<br />
festmachen.<br />
Philipp von Hutten reiste <strong>im</strong> Dezember 1534 mit Nikolaus Federmann von St. Lucar,<br />
an der Mündung <strong>des</strong> Guadalquivir gelegen, nach Venezuela ab. Das Horoskop für die<br />
Reise hat <strong>Faust</strong> wahrscheinlich auch in diesem Jahr erarbeitet. Der „Tuus <strong>Faust</strong>us“-<br />
77