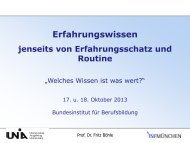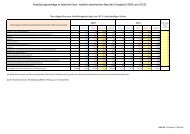- Seite 2 und 3:
Berufsbildungsbericht 2007 Die dual
- Seite 4 und 5:
Dienstleistungssektors 1 , der im V
- Seite 6 und 7:
4 2. Förderrunde verdoppelt und da
- Seite 8 und 9:
6 Jahr 2003 hatten noch 377.504 jun
- Seite 10 und 11:
8 aufgenommenen Schüler und Schül
- Seite 12 und 13:
� Übergangsmanagement 10 Insbeso
- Seite 14 und 15:
- besondere Gruppen wie Altbewerber
- Seite 16 und 17:
14 Anrechnungsmöglichkeiten für e
- Seite 18 und 19:
16 Bildungszeiten effektiver zu mac
- Seite 20 und 21:
hergestellt worden. Das Abstimmungs
- Seite 22 und 23:
20 ist eine um 34.938 größere Nac
- Seite 24 und 25:
oder 5,4% mehr). Auch in der Landwi
- Seite 26 und 27:
von Jugendlichen erhöht, die aus d
- Seite 28 und 29:
höhere Zahl der unvermittelten Bew
- Seite 30 und 31:
Übersicht 1: Neu abgeschlossene Au
- Seite 32 und 33:
Beschluss 1. Das Bundeskabinett bes
- Seite 34 und 35:
Stellungnahme des Hauptausschusses
- Seite 36 und 37:
Votum der Gruppe der Beauftragten d
- Seite 38 und 39:
Zu den zentralen Vereinbarungen des
- Seite 40 und 41:
8 Von zentraler Bedeutung für Lebe
- Seite 42 und 43:
10 verlieren bei den jungen Mensche
- Seite 44 und 45:
ekamen nur 31 Prozent der Hauptsch
- Seite 46 und 47:
Eine wahre Renaissance erleben derz
- Seite 48 und 49:
16 Überblick als auch den Anforder
- Seite 50 und 51:
18 Gewerkschaften als zu lang einge
- Seite 52 und 53:
Rahmenstoffplan sicherzustellen, ha
- Seite 54 und 55:
22 Austauschprozessen zwischen den
- Seite 56 und 57:
24 3. Mehr Durchlässigkeit in der
- Seite 58 und 59:
26 Zusammenhang mit der Ausbildungs
- Seite 60 und 61:
erufsbildenden Systems prägen. Die
- Seite 62 und 63:
30 Da betriebliche Praxis aber für
- Seite 64 und 65:
Berufsbildungsbericht 2007 (Teil II
- Seite 66 und 67:
1.1.1 Möglichkeiten und Grenzen be
- Seite 68 und 69:
4 Berufsbildungsbericht 1982 heißt
- Seite 70 und 71:
6 Ende des Vermittlungsjahres nach
- Seite 72 und 73:
8 erprobt. Im Auftrag des hessische
- Seite 74 und 75:
10 Zahl der Neuabschlüsse in der H
- Seite 76 und 77:
12 Schaubild: 1.1.1/2: Neu abgeschl
- Seite 78 und 79:
14 Schulabschlüsse und Noten zu ei
- Seite 80 und 81:
16 demnach im Jahr 2005 hochgerechn
- Seite 82 und 83:
Schaubild: 1.1.1/4: Veränderungsra
- Seite 84 und 85:
20 Industrie und Handel Die Zahl de
- Seite 86 und 87:
Schaubild 1.1.1/5 enthält eine gra
- Seite 88 und 89:
24 auf ein Plus von 3.257 und damit
- Seite 90 und 91:
26 Sozialversicherungsfachangestell
- Seite 92 und 93:
28 von Steigerungen nur unterpropor
- Seite 94 und 95:
1.1.3 Entwicklung der unbesetzten S
- Seite 96 und 97:
32 In den alten Ländern war die sc
- Seite 98 und 99:
34 1.2 Regionale Entwicklung der Be
- Seite 100 und 101:
36 verzeichnen waren. Auch schienen
- Seite 102 und 103:
38 Gegensatz zu den Arbeitsagenture
- Seite 104 und 105:
40 Um die beruflichen Orientierunge
- Seite 106 und 107:
42 ähnlich stark an einer dualen A
- Seite 108 und 109:
44 (Vorjahr 36,9 %) der Absolventen
- Seite 110 und 111:
46 machen ein Praktikum und 3,0 % a
- Seite 112 und 113:
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20
- Seite 114 und 115:
50 gegen Schulende einen betrieblic
- Seite 116 und 117:
52 einen zweijährigen berufsfachsc
- Seite 118 und 119:
54 andere Berufsausbildung waren 11
- Seite 120 und 121:
56 13 % der Schulabgänger und Schu
- Seite 122 und 123:
58 eine betriebliche Ausbildungsste
- Seite 124 und 125:
60 geringe Personenzahl der jünger
- Seite 126 und 127:
einzuwerben. Zusätzlich sagten die
- Seite 128 und 129:
64 Einstiegsqualifizierung absolvie
- Seite 130 und 131:
Potenzialanalysen. Im Jahr 2006 fan
- Seite 132 und 133:
Zukünftige Förderrunden 68 Die dr
- Seite 134 und 135:
Die Förderrichtlinien wurden aufgr
- Seite 136 und 137:
72 der dritten, vierten und fünfte
- Seite 138 und 139:
Förderplätze zuständigen staatli
- Seite 140 und 141:
Ausbildungsberufen wirken sich kaum
- Seite 142 und 143:
1.4.6 Tarifliche Ausbildungsförder
- Seite 144 und 145:
Schaubild 1.4.6/1 Vereinbarungen zu
- Seite 146 und 147:
Schaubild 1.4.6/2: Vereinbarungen z
- Seite 148 und 149:
84 Im Rahmen der tariflichen Ausbil
- Seite 150 und 151:
Die hier durchgeführten Voraussch
- Seite 152 und 153:
Quoten werden anschließend auf die
- Seite 154 und 155:
zuletzt knapp 60.000 Ausbildungsbeg
- Seite 156 und 157:
92 � Die zweite Variante rechnet
- Seite 158 und 159:
Das BIBB hat hierzu die Entwicklung
- Seite 161 und 162:
97 2. Bestand und Struktur der Beru
- Seite 163 und 164:
99 dem Übergangssystem (Bildungsg
- Seite 165 und 166:
101 Berufsausbildung in BBiG/HwO-Be
- Seite 167 und 168:
103 Stellung bzw. Ausgestaltung der
- Seite 169 und 170:
105 Auszubildende mit oder ohne Hau
- Seite 171 und 172:
107 Die Quoten der Auszubildenden m
- Seite 173 und 174:
109 die Altersjahre so kann man die
- Seite 175 und 176:
111 Danach hat derzeit fast jeder f
- Seite 177 und 178:
113 Hochgerechnet sind rund 41.000
- Seite 179 und 180:
115 Im Untersuchungszeitraum von 19
- Seite 181 und 182:
117 Anlagenmechaniker für Sanitär
- Seite 183 und 184:
119 Die Anzahl der Auszubildenden a
- Seite 185 und 186:
121 Ausbildungsplätzen als Ausweic
- Seite 187 und 188:
123 Dagegen weicht der Beruf Verkä
- Seite 189 und 190:
125 insgesamt. Zwar konnten die Ext
- Seite 191 und 192:
127 Jahr 1940 stammende Beruf Teile
- Seite 193 und 194:
129 gerade bei einer verbesserten K
- Seite 195 und 196:
131 der Auszubildenden 5,6 % auf so
- Seite 197 und 198:
133 Schaubild 2.3.1/1: Entwicklung
- Seite 199 und 200:
135 ermittelten Indizes der Tarifl
- Seite 201 und 202:
137 - Zu den beruflichen Schulen (T
- Seite 203 und 204:
139 Auch im Berichtsjahr fiel der N
- Seite 205 und 206:
141 Bezogen auf diese Betriebskohor
- Seite 207 und 208:
143 Wird ein Personalbedarf von den
- Seite 209 und 210:
145 Personalbedarf und Rekrutierung
- Seite 211 und 212:
147 Berufsfachschulen gemäß BBiG/
- Seite 213 und 214:
700.000 600.000 500.000 400.000 300
- Seite 215 und 216:
151 Berufsfachschulen (BFS) 2005/20
- Seite 217 und 218:
153 Zu den Ausbildungswegen mit Ber
- Seite 219 und 220:
155 Die Veränderungsraten an Beruf
- Seite 221 und 222:
157 � Beibehaltung des Status quo
- Seite 223 und 224:
159 Neben den Schulen für das Gesu
- Seite 225 und 226:
161 Württembergs dreijährige aner
- Seite 227 und 228:
163 3. Strukturelle Weiterentwicklu
- Seite 229 und 230:
165 unverändert hohen Stellenwert
- Seite 231 und 232:
167 Ergebnisse dienen als Grundlage
- Seite 233 und 234:
165 durchgeführt wird, als Teil 1
- Seite 235 und 236:
167 Berufe reformiert, sondern dar
- Seite 237 und 238: 169 � Rückkoppelung mit dem Mode
- Seite 239 und 240: 171 berufsbildungs- und arbeitsmark
- Seite 241 und 242: 173 � hat ein Interesse an der ei
- Seite 243 und 244: 175 � Begleitung der betriebliche
- Seite 245 und 246: 177 für die Berufe in der Versorgu
- Seite 247 und 248: 179 Lernarrangements werden definie
- Seite 249 und 250: 181 Früherkennungsnetzwerkes Skill
- Seite 251 und 252: 183 Früherkennungsforschung zum Th
- Seite 253 und 254: 185 System zur Qualifikationsbedarf
- Seite 255 und 256: 187 Veränderungen beim Qualifikati
- Seite 257 und 258: 189 und bei den IT-Qualifikationen
- Seite 259 und 260: 191 Maßnahmen nach dem neuen Fachk
- Seite 261 und 262: Folgende Änderungen wurden umgeset
- Seite 263 und 264: 195 Ergänzend beabsichtigt die BA
- Seite 265 und 266: 197 Das im Jahr 2001 implementierte
- Seite 267 und 268: 199 Als Foren boten die Entwicklung
- Seite 269 und 270: 201 Das GPC-Portal trägt mit seine
- Seite 271 und 272: 203 � Angebote der Jugendberufshi
- Seite 273 und 274: 205 durch die Einbeziehung der Beru
- Seite 275 und 276: 207 in allen Punkten. Sie werden oh
- Seite 277 und 278: 209 bundesweit 156 Projekte ausgew
- Seite 279 und 280: 211 Zur Verbreitung und strukturell
- Seite 281 und 282: 213 sie von 34,0 % auf 36,6 %, bei
- Seite 283 und 284: 215 zwischen Betriebsgröße und Ü
- Seite 285 und 286: 217 (ohne Auszubildende). Als Erwer
- Seite 287: 219 Berufsverlauf bisher unterschie
- Seite 291 und 292: 223 Interessen und Freizeitaktivit
- Seite 293 und 294: 225 technikorientierten bzw. nicht
- Seite 295 und 296: 227 durch Checklisten, Formulare un
- Seite 297 und 298: 229 vier Bereiche „magazine“ (I
- Seite 299 und 300: 231 Anfang September 2006 wurde die
- Seite 301 und 302: 233 „Women Exist“ Das vom BMBF
- Seite 303 und 304: 235 diesen Aufgaben gerecht werden
- Seite 305 und 306: 237 verschiedenen Rubriken wie z. B
- Seite 307 und 308: 4. Berufliche Weiterbildung 239 4.1
- Seite 309 und 310: 241 Logistikbereich und die Neuerun
- Seite 311 und 312: 243 Mit der Umsetzung der Hartz-Ref
- Seite 313 und 314: 245 Neben dem deutlichen Rückgang
- Seite 315 und 316: 247 Zur Zeit 243 findet eine Übera
- Seite 317 und 318: 249 4.1.7 Fernunterricht - Anbieter
- Seite 319 und 320: 251 einzelnen Ausbildungsbereiche b
- Seite 321 und 322: 253 Fortbildungsabschlüsse im Bere
- Seite 323 und 324: 255 39,4 %. Bei den Fremdsprachenku
- Seite 325 und 326: 257 Nachfrage von rund 770 Prüfung
- Seite 327 und 328: 259 Bzgl. Inhalt und Form der Prüf
- Seite 329 und 330: 261 4.2.2.a Programm „Arbeiten -
- Seite 331 und 332: Langfristige Zielsetzungen: 263 �
- Seite 333 und 334: 265 Im Jahre 2005 gab es insgesamt
- Seite 335 und 336: � Personalmanagement 267 � Volk
- Seite 337 und 338: 269 beinhalten: 57 % verfügen übe
- Seite 339 und 340:
is 49 Tln 50 bis 99 Tln 100 bis 249
- Seite 341 und 342:
273 wbmonitor zukünftig ausdrückl
- Seite 343 und 344:
275 verbundene Verbraucheraufkläru
- Seite 345 und 346:
277 Das Projekt „Graduiertennetzw
- Seite 347 und 348:
279 Insbesondere in KMU wurden spez
- Seite 349 und 350:
281 Umfeld erworbenen Kompetenzen w
- Seite 351 und 352:
283 (auch externen) Lerndienstleist
- Seite 353 und 354:
285 uneingeschränkt offen. Die Zah
- Seite 355 und 356:
287 angestrebt, wie die Erhöhung d
- Seite 357 und 358:
289 Sozialparteien hierfür sogar 2
- Seite 359 und 360:
291 Allerdings wird der informelle
- Seite 361 und 362:
293 qualifizieren, führt die SICK
- Seite 363 und 364:
295 „Lernen in der Stadt / Region
- Seite 365 und 366:
- Selbststeuerung - Kompetenzentwic
- Seite 367 und 368:
299 Derzeit werden bundesweit 70 Le
- Seite 369 und 370:
www.lernende-regionen.info. 301 Im
- Seite 371 und 372:
303 unterschiedliche Zielgruppen, z
- Seite 373 und 374:
305 immer ein flächendeckendes Ang
- Seite 375 und 376:
307 5. Europäische und internation
- Seite 377 und 378:
309 systematische und strukturierte
- Seite 379 und 380:
311 Dem Vorschlag der Europäischen
- Seite 381 und 382:
311 Die Chance von ECVET soll darin
- Seite 383 und 384:
313 Als weitere nationale Prioritä
- Seite 385 und 386:
315 EUROPASS Das EUROPASS Rahmenkon
- Seite 387 und 388:
317 � Unterstützung aller mit be
- Seite 389 und 390:
319 Vordergrund stehenden Aspekte u
- Seite 391 und 392:
321 von Auszubildenden und Berufsbi
- Seite 393 und 394:
323 flankierende Infrastruktur zur
- Seite 395 und 396:
325 Breite und vielfältige Beratun
- Seite 397 und 398:
327 Kroatien: Arbeitsmarktorientier
- Seite 399 und 400:
329 Vereinheitlichung der Strukture
- Seite 401 und 402:
331 von Facharbeitern und Lehrkräf
- Seite 403 und 404:
333 iMOVE hat sich seit 2001 inzwis
- Seite 405 und 406:
Quelle: Bundesagentur für Arbeit,
- Seite 407 und 408:
Übersicht 1.3.2/1: Berufliche Plä
- Seite 409 und 410:
Übersicht 1.3.2/3: Realisierte Ber
- Seite 411 und 412:
Übersicht 1.4/2: Drei alternative
- Seite 413 und 414:
Übersicht 1.5/2: Drei alternative
- Seite 415 und 416:
Übersicht 2.1/2: Zahl der Ausbildu
- Seite 417 und 418:
Übersicht 2.2.1/2: Schulische Vorb
- Seite 419 und 420:
Übersicht 2.2.1/4: Die zehn von Au
- Seite 421 und 422:
Übersicht 2.2.1/6: Die zehn von Au
- Seite 423 und 424:
Übersicht 2.2.1/8: Schüler an Ber
- Seite 425 und 426:
Übersicht 2.2.2/1: Deutsche Studie
- Seite 427 und 428:
Übersicht 2.2.2/3: Wichtige Studie
- Seite 429 und 430:
Übersicht 2.2.3/2: Auszubildende n
- Seite 431 und 432:
Übersicht 2.2.3/4: Auszubildende i
- Seite 433 und 434:
Übersicht 2.2.3/6: Weibliche Auszu
- Seite 435 und 436:
Übersicht 2.2.3/8: Gesamtzahl der
- Seite 437 und 438:
Übersicht 2.2.4/2: Ausländische A
- Seite 439 und 440:
Übersicht 2.2.4/4: Die zehn am st
- Seite 441 und 442:
Übersicht 2.2.5/1: Teilnehmer und
- Seite 443 und 444:
Übersicht 2.2.5/3: Externe Prüfun
- Seite 445 und 446:
Übersicht 2.2.6/2: Anteil der neu
- Seite 447 und 448:
2005 1 Übersicht 2.2.7/2: Anteil v
- Seite 449 und 450:
Übersicht 2.2.7/4: Anteil der vorz
- Seite 451 und 452:
Übersicht 2.3.1/1: Anstieg der Tar
- Seite 453 und 454:
Übersicht 2.3.2/1: Aufwendungen f
- Seite 455 und 456:
Übersicht 2.4/1: Betriebe 1) und A
- Seite 457 und 458:
Übersicht 2.4/11: Sotialversicheru
- Seite 459 und 460:
Tabelle 2.4/13: Stabilität der bet
- Seite 461 und 462:
Übersicht 2.4/3: Betriebe 1) und A
- Seite 463 und 464:
Übersicht 2.4/5 Sozialversicherung
- Seite 465 und 466:
Übersicht 2.4/7: Betriebe 1) und A
- Seite 467 und 468:
Übersicht 2.4/9: Betriebe 1) und A
- Seite 469 und 470:
Übersicht 2.5.3/2: Ausbildung an B
- Seite 471 und 472:
Übersicht 2.5.3/4: Die zehn im 1.
- Seite 473 und 474:
Übersicht 2.5.3/6: Schülerzahlen
- Seite 475 und 476:
Übersicht 3.2.1/1 Neue Ausbildungs
- Seite 477 und 478:
Übersicht 3.2.1/3 Ausbildungsordnu
- Seite 479 und 480:
Übersicht 3.2.1/4 Implementation u
- Seite 481 und 482:
Übersicht 3.5.1/1 Austritte aus au
- Seite 483 und 484:
Übersicht 3.5.1/3: Förderung der
- Seite 485 und 486:
Übersicht 3.6.1/2: Erfolgreiche Au
- Seite 487 und 488:
Übersicht 3.6.1/4: Anteil weiblich
- Seite 489 und 490:
Übersicht 3.6.2/2: Tätigkeit im e
- Seite 491 und 492:
Übersicht 4.1.1/1: Eintritte und J
- Seite 493 und 494:
Übersicht 4.1.3/1: Fortbildungspr
- Seite 495 und 496:
Übersicht 4.1.3/2: Fortbildungspr
- Seite 497 und 498:
Übersicht 4.1.8/1: Bestandene Ausb
- Seite 499 und 500:
Übersicht 4.1.8/3: Bestandene Meis
- Seite 501 und 502:
Übersicht 4.3.1/1 Von Weiterbildun
- Seite 503 und 504:
Tabelle 1.1.1/2: Veränderungen der
- Seite 505 und 506:
Tabelle 1.1.1/4: Entwicklung der ne
- Seite 507 und 508:
Tabelle 1.1.1/4: Entwicklung der ne
- Seite 509 und 510:
Tabelle 1.1.1/4: Entwicklung der ne
- Seite 511 und 512:
Tabelle 1.1.1/6: Ausbildungsverträ
- Seite 513 und 514:
Tabelle 1.1.1/7: Neu abgeschlossene
- Seite 515 und 516:
Tabelle 1.1.1/7: Neu abgeschlossene
- Seite 517 und 518:
Tabelle 1.1.1./8: Übersicht über
- Seite 519 und 520:
Tabelle 1.1.2/2: Unbesetzte Berufsa
- Seite 521 und 522:
Tabelle 1.2.1: Ausgewählte Indikat
- Seite 523 und 524:
ungünstiger Ausbildungsstellen Ess
- Seite 525 und 526:
Tabelle 1.4/1: Entwicklung der Zahl
- Seite 527 und 528:
Tabelle 4.1.10.1 Begabtenförderung
- Seite 529 und 530:
Programme der Länder zur finanziel
- Seite 531 und 532:
Programme der Länder zur finanziel
- Seite 533 und 534:
Programme der Länder zur finanziel
- Seite 535 und 536:
Programme der Länder zur finanziel
- Seite 537:
Programme der Länder zur finanziel