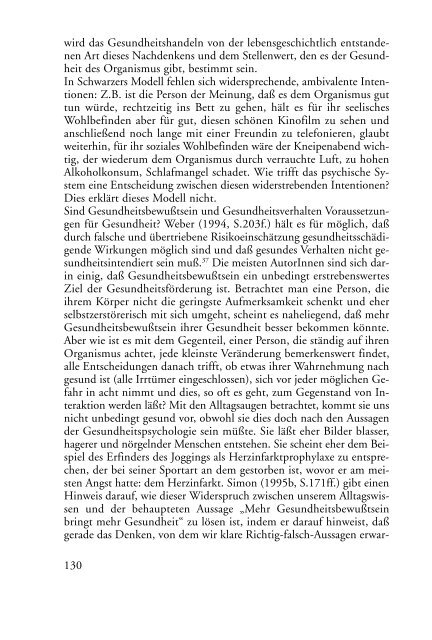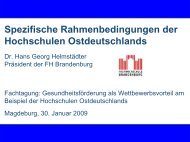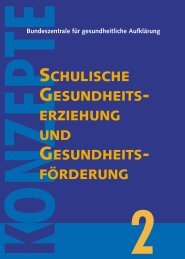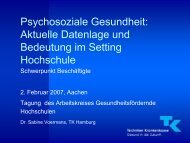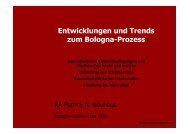Gesundheit läßt sich nicht lehren - Arbeitskreis ...
Gesundheit läßt sich nicht lehren - Arbeitskreis ...
Gesundheit läßt sich nicht lehren - Arbeitskreis ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
wird das <strong>Gesundheit</strong>shandeln von der lebensgeschichtlich entstandenen<br />
Art dieses Nachdenkens und dem Stellenwert, den es der <strong>Gesundheit</strong><br />
des Organismus gibt, bestimmt sein.<br />
In Schwarzers Modell fehlen <strong>sich</strong> widersprechende, ambivalente Intentionen:<br />
Z.B. ist die Person der Meinung, daß es dem Organismus gut<br />
tun würde, rechtzeitig ins Bett zu gehen, hält es für ihr seelisches<br />
Wohlbefinden aber für gut, diesen schönen Kinofilm zu sehen und<br />
anschließend noch lange mit einer Freundin zu telefonieren, glaubt<br />
weiterhin, für ihr soziales Wohlbefinden wäre der Kneipenabend wichtig,<br />
der wiederum dem Organismus durch verrauchte Luft, zu hohen<br />
Alkoholkonsum, Schlafmangel schadet. Wie trifft das psychische System<br />
eine Entscheidung zwischen diesen widerstrebenden Intentionen?<br />
Dies erklärt dieses Modell <strong>nicht</strong>.<br />
Sind <strong>Gesundheit</strong>sbewußtsein und <strong>Gesundheit</strong>sverhalten Voraussetzungen<br />
für <strong>Gesundheit</strong>? Weber (1994, S.203f.) hält es für möglich, daß<br />
durch falsche und übertriebene Risikoeinschätzung gesundheitsschädigende<br />
Wirkungen möglich sind und daß gesundes Verhalten <strong>nicht</strong> gesundheitsintendiert<br />
sein muß. 37 Die meisten AutorInnen sind <strong>sich</strong> darin<br />
einig, daß <strong>Gesundheit</strong>sbewußtsein ein unbedingt erstrebenswertes<br />
Ziel der <strong>Gesundheit</strong>sförderung ist. Betrachtet man eine Person, die<br />
ihrem Körper <strong>nicht</strong> die geringste Aufmerksamkeit schenkt und eher<br />
selbstzerstörerisch mit <strong>sich</strong> umgeht, scheint es naheliegend, daß mehr<br />
<strong>Gesundheit</strong>sbewußtsein ihrer <strong>Gesundheit</strong> besser bekommen könnte.<br />
Aber wie ist es mit dem Gegenteil, einer Person, die ständig auf ihren<br />
Organismus achtet, jede kleinste Veränderung bemerkenswert findet,<br />
alle Entscheidungen danach trifft, ob etwas ihrer Wahrnehmung nach<br />
gesund ist (alle Irrtümer eingeschlossen), <strong>sich</strong> vor jeder möglichen Gefahr<br />
in acht nimmt und dies, so oft es geht, zum Gegenstand von Interaktion<br />
werden <strong>läßt</strong>? Mit den Alltagsaugen betrachtet, kommt sie uns<br />
<strong>nicht</strong> unbedingt gesund vor, obwohl sie dies doch nach den Aussagen<br />
der <strong>Gesundheit</strong>spsychologie sein müßte. Sie <strong>läßt</strong> eher Bilder blasser,<br />
hagerer und nörgelnder Menschen entstehen. Sie scheint eher dem Beispiel<br />
des Erfinders des Joggings als Herzinfarktprophylaxe zu entsprechen,<br />
der bei seiner Sportart an dem gestorben ist, wovor er am meisten<br />
Angst hatte: dem Herzinfarkt. Simon (1995b, S.171ff.) gibt einen<br />
Hinweis darauf, wie dieser Widerspruch zwischen unserem Alltagswissen<br />
und der behaupteten Aussage „Mehr <strong>Gesundheit</strong>sbewußtsein<br />
bringt mehr <strong>Gesundheit</strong>“ zu lösen ist, indem er darauf hinweist, daß<br />
gerade das Denken, von dem wir klare Richtig-falsch-Aussagen erwar-<br />
130