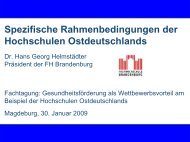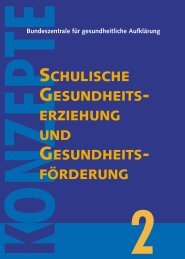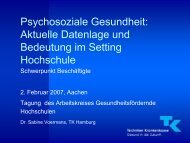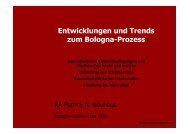Gesundheit läßt sich nicht lehren - Arbeitskreis ...
Gesundheit läßt sich nicht lehren - Arbeitskreis ...
Gesundheit läßt sich nicht lehren - Arbeitskreis ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bei genauerem Hinsehen erweist <strong>sich</strong> das Konzept der <strong>Gesundheit</strong>szirkel<br />
dann aber durchaus differenzierter: Zwei Modelle, das Berliner 4<br />
und das Düsseldorfer Modell 5 , standen bei leicht variierenden Ansätzen<br />
Pate. Dem Düsseldorfer Modell verwandt ist das Modell der <strong>Gesundheit</strong>sförderungskreise<br />
(Brandenburg, 1993a, S.80ff.), dem Berliner<br />
Modell ist verwandt das Modell des <strong>Gesundheit</strong>scoaching (Lieneke/<br />
Westermayer, 1993, S.87), das zugleich am stärksten Zielen der Erwachsenenbildung<br />
nahekommt.<br />
Das Berliner Modell stellt aus einer dem Konstruktivismus nahen Perspektive<br />
6 den Mangel an gelungener betriebsinterner Kommunikation<br />
in den Vordergrund der <strong>Gesundheit</strong>sbemühungen, weil das Wissen<br />
über gesundheitliche Probleme in den Arbeitsbedingungen bei den<br />
MitarbeiterInnen in der Regel vorhanden ist, aber <strong>nicht</strong> in ausreichendem<br />
Maß betriebsintern gehört wird. „<strong>Gesundheit</strong>szirkel sind zunächst<br />
einmal <strong>nicht</strong>s anderes als ein Versuch, die unterschiedlichen Träger des<br />
betrieblichen Erfahrungswissens miteinander in ein Gespräch zu bringen<br />
über <strong>Gesundheit</strong> im Betrieb: in ein Gespräch, das so gestaltet ist, daß es<br />
real etwas bewegt hin<strong>sich</strong>tlich der <strong>Gesundheit</strong> in diesem Betrieb“ (Friczewski,<br />
1993c, S.14). Die zu verändernden Ge<strong>sich</strong>tspunkte liegen dabei<br />
sowohl in physiologischen Bedingungen (Lärm, Luft, Körperhaltung<br />
etc.) als auch in psychosozialen Bedingungen (Verantwortung, Anerkennung<br />
etc.). Aus Sicht des Berliner Modells ist es sinnlos, einzelne<br />
ergonomische Mängel und physiologische Bedingungen zu verändern,<br />
„wenn der kollektiv betriebliche Kontext der Sprachlosigkeit, der die Mängel<br />
überhaupt erst zu einem Dauerzustand hat werden lassen, <strong>sich</strong> <strong>nicht</strong><br />
gleichzeitig mit transformiert“ (a.a.O., S.16). Durch das Gespräch im<br />
<strong>Gesundheit</strong>szirkel selbst wird dabei faktisch bereits etwas an den psychosozialen<br />
Bedingungen geändert, denn MitarbeiterInnen erfahren<br />
hier, daß ihre Meinung wichtig ist, daß sie gehört werden. Diese Erfahrung<br />
ist allerdings <strong>nicht</strong> widerstandslos möglich, da sie, ebenso wie<br />
überhaupt ein Denken, das psychosoziale <strong>Gesundheit</strong>sbedingungen<br />
kennt, zunächst quer zu allen Denkstrukturen und Erfahrungen im<br />
betrieblichen Zusammenhang liegt.<br />
Friczewski beschreibt anschaulich und nachvollziehbar, wie solche<br />
Sprachlosigkeit entsteht: Neue Arbeitsplätze werden unter Achtung<br />
einiger ergonomischer Ge<strong>sich</strong>tspunkte eingerichtet, der Arbeitsmittelplaner<br />
kommt aber <strong>nicht</strong> auf die Idee, die MitarbeiterInnen danach zu<br />
befragen, welche Bedingungen sie an ihrem Arbeitsplatz brauchen und<br />
wie sie damit zurechtkommen. Einige mutige MitarbeiterInnen ver-<br />
251