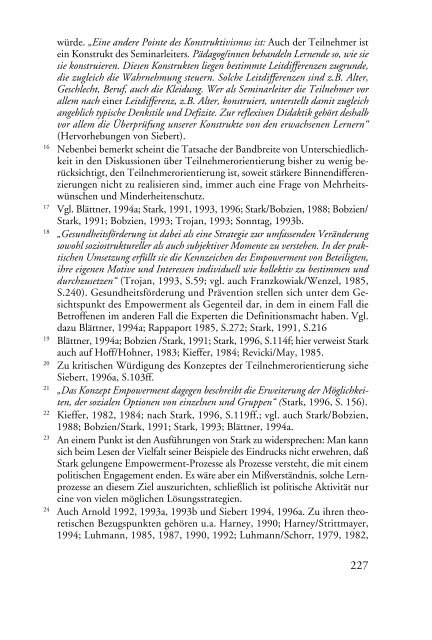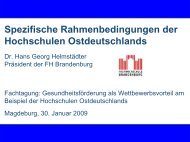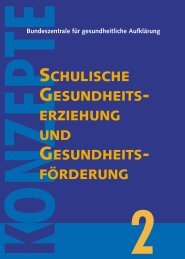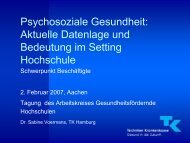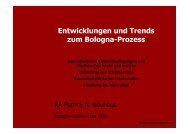Gesundheit läßt sich nicht lehren - Arbeitskreis ...
Gesundheit läßt sich nicht lehren - Arbeitskreis ...
Gesundheit läßt sich nicht lehren - Arbeitskreis ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
würde. „Eine andere Pointe des Konstruktivismus ist: Auch der Teilnehmer ist<br />
ein Konstrukt des Seminarleiters. Pädagog/innen behandeln Lernende so, wie sie<br />
sie konstruieren. Diesen Konstrukten liegen bestimmte Leitdifferenzen zugrunde,<br />
die zugleich die Wahrnehmung steuern. Solche Leitdifferenzen sind z.B. Alter,<br />
Geschlecht, Beruf, auch die Kleidung. Wer als Seminarleiter die Teilnehmer vor<br />
allem nach einer Leitdifferenz, z.B. Alter, konstruiert, unterstellt damit zugleich<br />
angeblich typische Denkstile und Defizite. Zur reflexiven Didaktik gehört deshalb<br />
vor allem die Überprüfung unserer Konstrukte von den erwachsenen Lernern“<br />
(Hervorhebungen von Siebert).<br />
16 Nebenbei bemerkt scheint die Tatsache der Bandbreite von Unterschiedlichkeit<br />
in den Diskussionen über Teilnehmerorientierung bisher zu wenig berück<strong>sich</strong>tigt,<br />
den Teilnehmerorientierung ist, soweit stärkere Binnendifferenzierungen<br />
<strong>nicht</strong> zu realisieren sind, immer auch eine Frage von Mehrheitswünschen<br />
und Minderheitenschutz.<br />
17 Vgl. Blättner, 1994a; Stark, 1991, 1993, 1996; Stark/Bobzien, 1988; Bobzien/<br />
Stark, 1991; Bobzien, 1993; Trojan, 1993; Sonntag, 1993b.<br />
18 „<strong>Gesundheit</strong>sförderung ist dabei als eine Strategie zur umfassenden Veränderung<br />
sowohl soziostruktureller als auch subjektiver Momente zu verstehen. In der praktischen<br />
Umsetzung erfüllt sie die Kennzeichen des Empowerment von Beteiligten,<br />
ihre eigenen Motive und Interessen individuell wie kollektiv zu bestimmen und<br />
durchzusetzen“ (Trojan, 1993, S.59; vgl. auch Franzkowiak/Wenzel, 1985,<br />
S.240). <strong>Gesundheit</strong>sförderung und Prävention stellen <strong>sich</strong> unter dem Ge<strong>sich</strong>tspunkt<br />
des Empowerment als Gegenteil dar, in dem in einem Fall die<br />
Betroffenen im anderen Fall die Experten die Definitionsmacht haben. Vgl.<br />
dazu Blättner, 1994a; Rappaport 1985, S.272; Stark, 1991, S.216<br />
19 Blättner, 1994a; Bobzien /Stark, 1991; Stark, 1996, S.114f; hier verweist Stark<br />
auch auf Hoff/Hohner, 1983; Kieffer, 1984; Revicki/May, 1985.<br />
20 Zu kritischen Würdigung des Konzeptes der Teilnehmerorientierung siehe<br />
Siebert, 1996a, S.103ff.<br />
21 „Das Konzept Empowerment dagegen beschreibt die Erweiterung der Möglichkeiten,<br />
der sozialen Optionen von einzelnen und Gruppen“ (Stark, 1996, S. 156).<br />
22 Kieffer, 1982, 1984; nach Stark, 1996, S.119ff.; vgl. auch Stark/Bobzien,<br />
1988; Bobzien/Stark, 1991; Stark, 1993; Blättner, 1994a.<br />
23 An einem Punkt ist den Ausführungen von Stark zu widersprechen: Man kann<br />
<strong>sich</strong> beim Lesen der Vielfalt seiner Beispiele des Eindrucks <strong>nicht</strong> erwehren, daß<br />
Stark gelungene Empowerment-Prozesse als Prozesse versteht, die mit einem<br />
politischen Engagement enden. Es wäre aber ein Mißverständnis, solche Lernprozesse<br />
an diesem Ziel auszurichten, schließlich ist politische Aktivität nur<br />
eine von vielen möglichen Lösungsstrategien.<br />
24 Auch Arnold 1992, 1993a, 1993b und Siebert 1994, 1996a. Zu ihren theoretischen<br />
Bezugspunkten gehören u.a. Harney, 1990; Harney/Strittmayer,<br />
1994; Luhmann, 1985, 1987, 1990, 1992; Luhmann/Schorr, 1979, 1982,<br />
227