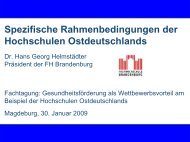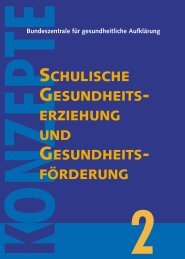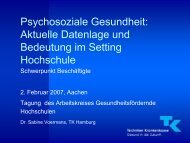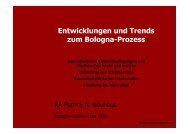Gesundheit läßt sich nicht lehren - Arbeitskreis ...
Gesundheit läßt sich nicht lehren - Arbeitskreis ...
Gesundheit läßt sich nicht lehren - Arbeitskreis ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4 Evolution ist z.B. <strong>nicht</strong> zu verstehen als ein Prozeß, in dem <strong>sich</strong> Lebewesen an<br />
die umgebende Welt besser anpassen, sondern als ein strukturelles Driften, das<br />
Ergebnis der unterschiedlichen individuellen Interaktionsweisen mit Unregelmäßigkeiten<br />
der Umgebung ist, bei gleichzeitiger fortwährender phylogenetischer<br />
Selektion, in der einige Lebewesen destruktive Interaktionen erfahren<br />
(Maturana/Varela, 1991, S.127). Autopoietisches System und Umwelt können<br />
<strong>sich</strong> dabei miteinander verändern.<br />
5 In verschiedenen Darstellungen zum Thema Konstruktivismus tauchen immer<br />
wieder die Begriffe Störung, Störeinwirkung oder Verstörung auf. Wie in der<br />
Übersetzung des Buches von Maturana und Varela soll hier aber bei dem<br />
Begriff Perturbation geblieben werden, da Störung im Deutschen negativ verstanden<br />
wird, der Begriff Verstörung das Gemeinte wohl eher trifft, aber auf<br />
soziale oder psychische Vorgänge bezogen ist.<br />
6 Simon bezieht <strong>sich</strong> auf die beiden Neurobiologen Humberto Maturana und<br />
Francisca Varela (1991) aber auch auf die konstruktivistische Sichtweise sozialer<br />
Systeme bei Luhmann (1994), auf von Foerster (1977, nach Simon<br />
1995a) und Glasersfeld (1981, nach Simon 1995a).<br />
7 Sinn hat allenfalls eine unspezifische Prävention im Sinne einer Balance von<br />
Bedingungen, z.B. angemessenes Gleichgewicht von Spannung und Entspannung,<br />
Ruhe und Bewegung, oder Vielfältigkeit des Nahrungsangebotes,<br />
sauerstoffreiche Luft, Vermeidung von Schadstoffen etc., damit die Substanzen<br />
für innere Prozesse zur Verfügung stehen können, die Gestaltung von<br />
Lebensbedingungen, soweit sie beeinflußbar sind, die der Autopoiese Bedingungen<br />
schafft, die ihre die Aufrechterhaltung der Autopoiese erleichtern. Dies<br />
garantiert aber <strong>nicht</strong> das Ausbleiben von Krankheit.<br />
8 Becker selbst geht <strong>nicht</strong> von einer konstruktivistischen Sichtweise aus!<br />
9 Vgl. hierzu paradoxe Interventionen bei Simon, 1995a, S.97ff.<br />
10 (Blättner, 1994a; Klesse/Sonntag u.a., 1992, S.46ff.; Antonovsky 1979, 1987,<br />
1991; Dlugosch, 1994b, S.102f.; Rosenbrock, 1993a, S.129; Waller, 1995, S.<br />
14ff.).<br />
11 Für Antonovsky geht es um das Wunder, daß Menschen trotz belastender<br />
Bedingungen gesund bleiben. Konstruktivistisch geht es um das Phänomen,<br />
daß die Selbstheilungsmechanismen einen als krank definierten Zustand hervorbringen<br />
können.<br />
12 Dennoch sieht Becker auch Schwachstellen an Antonovskys Konzept: die ausschließlich<br />
körperliche Sichtweise von <strong>Gesundheit</strong>-Krankheit und die ungenügende<br />
Analyse der Beziehungen zwischen seelischer und körperlicher <strong>Gesundheit</strong>,<br />
die ausschließliche Verwendung negativer Indikatoren wie Schmerzen<br />
oder funktionale Beeinträchtigungen für <strong>Gesundheit</strong>, die erst skizzenhafte<br />
Ausarbeitung und bisher nur begrenzte empirische Überprüfung des Modells<br />
(Becker, 1992, S.48).<br />
156