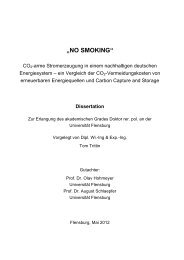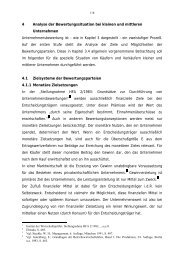- Seite 1:
Das pragmatische Konzept für den B
- Seite 4 und 5:
Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort 6 2 De
- Seite 6 und 7:
1 Vorwort Die Bruchrechnung nimmt e
- Seite 8 und 9:
Im Folgenden werde ich zwei innerma
- Seite 10 und 11:
2 Der Sinn des Bruchrechenunterrich
- Seite 12 und 13:
- Mehr Zeit für Dezimalbrüche - Z
- Seite 14 und 15:
deren Alltagsrelevanz sich einem ni
- Seite 16 und 17:
Er ist 1 7 : cm = 7 · 10 000 000 c
- Seite 18 und 19:
Weitere Beispiele dafür, dass die
- Seite 20 und 21:
3 Die Ausgangslage Bei der Ausarbei
- Seite 22 und 23:
sie dies aufgrund der Formulierung
- Seite 24 und 25:
Wenn man sich an diese Aussage häl
- Seite 26 und 27:
* Haben die Brüche den gleichen Ne
- Seite 28 und 29:
Ein grundsätzliches Ärgernis von
- Seite 30 und 31:
4 5 anzuklicken, aber es ist nicht
- Seite 32 und 33:
Das bedeutet, dass sich 2 1 und 4 1
- Seite 34 und 35:
etrachtet man drei aufeinanderfolge
- Seite 36 und 37:
erweitert, sondern ihre Theorie mit
- Seite 38 und 39:
Teil der französischen Schülerinn
- Seite 40 und 41:
Welche Reaktionen gäbe es, wenn ke
- Seite 42 und 43:
(links) vom Ergebnis (rechts), den
- Seite 44 und 45:
„Aufgabe“ und drei „Ergebniss
- Seite 46 und 47:
links stehende Aufgabe vom rechts s
- Seite 48 und 49:
geschrieben zu werden brauchen. Der
- Seite 50 und 51:
links nach rechts sowohl die Minuen
- Seite 52 und 53:
Solange Schülerinnen und Schüler
- Seite 54 und 55:
Bruchrechenunterrichts werden, wie
- Seite 56 und 57:
Eine der häufigsten falschen Vorst
- Seite 58 und 59:
nirgends der deutliche Hinweis gesc
- Seite 60 und 61:
„Bruchzahl“. Die dahinter steck
- Seite 62 und 63:
Im „Lehrplan des Landes Schleswig
- Seite 64 und 65:
Unter einem „Dezimalbruch“ kön
- Seite 66 und 67:
So steht 2 5 für 5 + 3 2 3 , währ
- Seite 68 und 69:
Ist diese große Anzahl von Begriff
- Seite 70 und 71:
also 3 7 der Kehrbruch. Da sich die
- Seite 72 und 73:
einen anderen dividieren und der Qu
- Seite 74 und 75:
5 Innermathematische Konzepte Inner
- Seite 76 und 77:
Beweis: Sei a ∈ 0 , seien b, c
- Seite 78 und 79:
Die so definierte Addition ist eine
- Seite 80 und 81:
Die Division ist in keine innere Ve
- Seite 82 und 83:
c e a Zur Eindeutigkeit: seien nun
- Seite 84 und 85:
Satz 8: Die Multiplikation ist in
- Seite 86 und 87:
Um den Körper ( , +, ·) aus ( ≥
- Seite 88 und 89:
Diese Menge ist wohldefiniert, zu j
- Seite 90 und 91: 6 Bisherige didaktische Konzepte f
- Seite 92 und 93: In diesem Fall darf auch g’ = g :
- Seite 94 und 95: Eines der Probleme besteht darin, d
- Seite 96 und 97: Die Liste der alltagsrelevanten Br
- Seite 98 und 99: „mal 5“-Operator hintereinander
- Seite 100 und 101: 3. Wie können wir erkennen, welche
- Seite 102 und 103: 117 wählen und erhielte dann als n
- Seite 104 und 105: 1 2 l -Flaschen abgefüllt werden s
- Seite 106 und 107: 6.2 Das Operatorkonzept Das Operato
- Seite 108 und 109: insbesondere auch mit natürlichen
- Seite 110 und 111: 2. Wie kann man Brüche darstellen?
- Seite 112 und 113: Problem besteht darin, auf einfache
- Seite 114 und 115: Es gibt Bücher, die nun einen Bruc
- Seite 116 und 117: - Die Einführung der Division wird
- Seite 118 und 119: 5. Wie können wir Brüche multipli
- Seite 120 und 121: um das Erweitern der Bruchdarstellu
- Seite 122 und 123: (a · x) : (c · y) = b : d Diese l
- Seite 124 und 125: Befürworter Freudenthal, dass es n
- Seite 126 und 127: sie zwar mit dem stumpfen, formalen
- Seite 128 und 129: haben den großen Vorteil, dass sie
- Seite 130 und 131: seien einfache Brüche und kämen m
- Seite 132 und 133: Insbesondere ist zu klären, ob die
- Seite 134 und 135: Gründe für die Annahme, dass die
- Seite 136 und 137: erneut gefragt. Dieses Experiment h
- Seite 138 und 139: sind, als Piaget behauptete, herrsc
- Seite 142 und 143: schnell überlastet. Wenn man ameri
- Seite 144 und 145: In den letzten Jahrzehnten ist eine
- Seite 146 und 147: Dass auch in modernen Gesellschafte
- Seite 148 und 149: Man geht heute davon aus, dass auch
- Seite 150 und 151: Möglicherweise verursacht schon di
- Seite 152 und 153: Stunden täglich oder mindestes 3 S
- Seite 154 und 155: fördere die Hand-Auge-Koordination
- Seite 156 und 157: Phantasie-Welt, in der sie mit Schw
- Seite 158 und 159: Gee beschreibt einen vierphasigen P
- Seite 160 und 161: Fachmagazine durchstöbert, Freunde
- Seite 162 und 163: zumindest Dittmann 122 , der bei de
- Seite 164 und 165: „Hierbei werden zunächst 3 Plät
- Seite 166 und 167: Sowohl Padberg 125 als auch Wartha
- Seite 168 und 169: Bemerkenswert ist, dass im Buch aus
- Seite 170 und 171: noch in 4 Portionen oder an die 4 b
- Seite 172 und 173: Bereich der natürlichen Zahlen bes
- Seite 174 und 175: Möglichkeiten, einen Bruch darzust
- Seite 176 und 177: Es gilt: 2 5 4 5 6 5 8 5 10 5 < < <
- Seite 178 und 179: Natürlich gibt es weitere Strategi
- Seite 180 und 181: Das bedeutet, sie schreiben wieder
- Seite 182 und 183: Beispielen 6 6 5 + = und 3 2 1 30 1
- Seite 184 und 185: ∀a ∈ 0 ∀c , b, d ∈ : a ⋅
- Seite 186 und 187: Dividend und Kehrbruch des Divisors
- Seite 188 und 189: einen Nachfolger. Die Zahlen sind n
- Seite 190 und 191:
Padberg und Wartha haben viele Fehl
- Seite 192 und 193:
12 18 Erleichterung sein, denn der
- Seite 194 und 195:
Beschreibung der Vorgehensweise üb
- Seite 196 und 197:
eindringlich darüber informiere, d
- Seite 198 und 199:
Kompetenz gefordert als das rein fo
- Seite 200 und 201:
natürlichen Zahlen so wie Perlen a
- Seite 202 und 203:
Im rechten Bild könnte man wie im
- Seite 204 und 205:
Es zeigt sich deutlich, dass ein Br
- Seite 206 und 207:
Anzahl sei n. Wenn es dann z markie
- Seite 208 und 209:
a c dann ist für jede beliebige Gr
- Seite 210 und 211:
Es bieten sich hier sehr viele Lös
- Seite 212 und 213:
esonders gut für eine Visualisieru
- Seite 214 und 215:
ist es aber nicht mehr erforderlich
- Seite 216 und 217:
„Der Musikunterricht dauert ein L
- Seite 218 und 219:
man durch Multiplikation mit einer
- Seite 220 und 221:
Zehnerpotenz. Eine wichtige Erkennt
- Seite 222 und 223:
1 1 13,02 bedeutet demnach 1⋅ 10
- Seite 224 und 225:
Von der Bruch- zur Kommadarstellung
- Seite 226 und 227:
40 : 7 100000 5 5 = + : 7 , man not
- Seite 228 und 229:
vorstellen werde. Dieser Algorithmu
- Seite 230 und 231:
221 Also ist 0 ,0223= . 9900 Rechne
- Seite 232 und 233:
Multiplikation Die Multiplikation m
- Seite 234 und 235:
8.1 Ein multiplikativer Algorithmus
- Seite 236 und 237:
Der Algorithmus ist der gleiche wie
- Seite 238 und 239:
Man erinnere sich, dass für den ge
- Seite 240 und 241:
17 85 68 102 34 51 7 5 8 2 4 1 Die
- Seite 242 und 243:
Multiplikatoren Die folgende Tabell
- Seite 244 und 245:
Die Rechnung ist dann kinderleicht
- Seite 246 und 247:
lim( −1+ ∑ ∞ i= 0 1 i 1 ( ) )
- Seite 248 und 249:
das Doppelte erhält. Somit muss an
- Seite 250 und 251:
Nicht verschwiegen werden sollen di
- Seite 252 und 253:
zu 3.: Wenn dieses wirklich ein Hin
- Seite 254 und 255:
Auf diese konkreten Brüche als Ein
- Seite 256 und 257:
Ein weiterer Schüler kam im letzte
- Seite 258 und 259:
verschiedene Weisen auf die Suche n
- Seite 260 und 261:
ersten Mal auftauchten, ist auch kl
- Seite 262 und 263:
können und deswegen seinen Sinn ni
- Seite 264 und 265:
Mitte der Tafel. Ich wollte sehen,
- Seite 266 und 267:
werden, da sie ja zuerst 11 und dan
- Seite 268 und 269:
überhaupt kein Thema. Es konnte au
- Seite 270 und 271:
Anschließend übten wir das Kürze
- Seite 272 und 273:
Wir sahen später, dass manchmal au
- Seite 274 und 275:
Nun ist ein Bruch, wenn er keine na
- Seite 276 und 277:
einen Blick darauf zu werfen, wie d
- Seite 278 und 279:
hier nicht die gemeinsamen Teiler e
- Seite 280 und 281:
Zähler und Nenner zweier Brüche d
- Seite 282 und 283:
Sachaufgaben mit Bruchteilen von Gr
- Seite 284 und 285:
1 28 1 1 1 1 + + + = und 14 7 4 2 1
- Seite 286 und 287:
Es ist völlig egal, welche beiden
- Seite 288 und 289:
entsteht dann, wenn man als Lehreri
- Seite 290 und 291:
Neben diesen beiden häufiger vorko
- Seite 292 und 293:
Schließlich wurde nach der Einfüh
- Seite 294 und 295:
5,2 · 3,3 = 15,6 Diese Fehler ware
- Seite 296 und 297:
296
- Seite 298 und 299:
Greenfield, P.M.: Die kulturelle Ev
- Seite 300 und 301:
Pohlmann, H.: Überwältigt von der
- Seite 302 und 303:
Inspizierte Schulbücher: Der neue