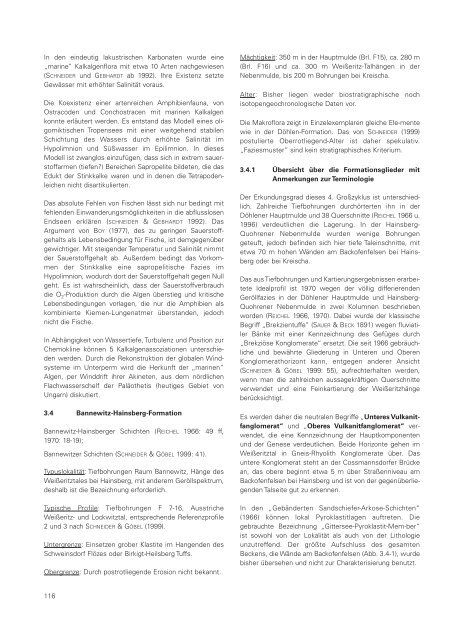Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
In den eindeutig lakustrischen Karbonaten wurde eine<br />
„marine” Kalkalgenflora mit etwa 10 Arten nachgewiesen<br />
(SCHNEIDER und GEBHARDT ab 1992). Ihre Existenz setzte<br />
Gewässer mit erhöhter Salinität voraus.<br />
Die Koexistenz einer artenreichen Amphibienfauna, von<br />
Ostracoden und Conchostracen mit marinen Kalkalgen<br />
konnte erläutert werden. Es entstand das Modell eines oligomiktischen<br />
Tropensees mit einer weitgehend stabilen<br />
Schichtung des Wassers durch erhöhte Salinität im<br />
Hypolimnion und Süßwasser im Epilimnion. In dieses<br />
Modell ist zwanglos einzufügen, dass sich in extrem sauerstoffarmen<br />
(tiefen?) Bereichen Sapropelite bildeten, die das<br />
Edukt der Stinkkalke waren und in denen die Tetrapodenleichen<br />
nicht disartikulierten.<br />
<strong>Das</strong> absolute Fehlen von Fischen lässt sich nur bedingt mit<br />
fehlenden Einwanderungsmöglichkeiten in die abflusslosen<br />
Endseen erklären (SCHNEIDER & GEBHARDT 1992). <strong>Das</strong><br />
Argument von BOY (1977), des zu geringen Sauerstoffgehalts<br />
als Lebensbedingung für Fische, ist demgegenüber<br />
gewichtiger. Mit steigender Temperatur und Salinität nimmt<br />
der Sauerstoffgehalt ab. Außerdem bedingt das Vorkommen<br />
der Stinkkalke eine sapropelitische Fazies im<br />
Hypolimnion, wodurch dort der Sauerstoffgehalt gegen Null<br />
geht. Es ist wahrscheinlich, dass der Sauerstoffverbrauch<br />
die O 2-Produktion durch die Algen überstieg und kritische<br />
Lebensbedingungen vorlagen, die nur die Amphibien als<br />
kombinierte Kiemen-Lungenatmer überstanden, jedoch<br />
nicht die Fische.<br />
In Abhängigkeit von Wassertiefe, Turbulenz und Position zur<br />
Chemokline können 5 Kalkalgenassoziationen unterschieden<br />
werden. Durch die Rekonstruktion der globalen Windsysteme<br />
im Unterperm wird die Herkunft der „marinen“<br />
Algen, per Winddrift ihrer Akineten, aus dem nördlichen<br />
Flachwasserschelf der Paläothetis (heutiges Gebiet von<br />
Ungarn) diskutiert.<br />
3.4 Bannewitz-Hainsberg-Formation<br />
Bannewitz-Hainsberger Schichten (REICHEL 1966: 49 ff,<br />
1970: 18-19);<br />
Bannewitzer Schichten (SCHNEIDER & GÖBEL 1999: 41).<br />
Typuslokalität: Tiefbohrungen Raum Bannewitz, Hänge des<br />
Weißeritztales <strong>bei</strong> Hainsberg, mit anderem Geröllspektrum,<br />
deshalb ist die Bezeichnung erforderlich.<br />
Typische Profile: Tiefbohrungen F 7-16, Ausstriche<br />
Weißeritz- und Lockwitztal, entsprechende Referenzprofile<br />
2 und 3 nach SCHNEIDER & GÖBEL (1999).<br />
Untergrenze: Einsetzen grober Klastite im Hangenden des<br />
Schweinsdorf Flözes oder Birkigt-Heilsberg Tuffs.<br />
Obergrenze: Durch postrotliegende Erosion nicht bekannt.<br />
116<br />
Mächtigkeit: 350 m in der Hauptmulde (Brl. F15), ca. 280 m<br />
(Brl. F16) und ca. 300 m Weißeritz-Talhängen in der<br />
Nebenmulde, bis 200 m Bohrungen <strong>bei</strong> Kreischa.<br />
Alter: Bisher liegen weder biostratigraphische noch<br />
isotopengeochronologische Daten vor.<br />
Die Makroflora zeigt in Einzelexemplaren gleiche Ele-mente<br />
wie in der Döhlen-Formation. <strong>Das</strong> von SCHNEIDER (1999)<br />
postulierte Oberrotliegend-Alter ist daher spekulativ.<br />
„Faziesmuster“ sind kein stratigraphisches Kriterium.<br />
3.4.1 Übersicht über die Formationsglieder mit<br />
Anmerkungen zur Terminologie<br />
Der Erkundungsgrad dieses 4. Großzyklus ist unterschiedlich.<br />
Zahlreiche Tiefbohrungen durchörterten ihn in der<br />
<strong>Döhlener</strong> Hauptmulde und 38 Querschnitte (REICHEL 1966 u.<br />
1996) verdeutlichen die Lagerung. In der Hainsberg-<br />
Quohrener Nebenmulde wurden wenige Bohrungen<br />
geteuft, jedoch befinden sich hier tiefe Taleinschnitte, mit<br />
etwa 70 m hohen Wänden am Backofenfelsen <strong>bei</strong> Hainsberg<br />
oder <strong>bei</strong> Kreischa.<br />
<strong>Das</strong> aus Tiefbohrungen und Kartierungsergebnissen erar<strong>bei</strong>tete<br />
Idealprofil ist 1970 wegen der völlig differierenden<br />
Geröllfazies in der <strong>Döhlener</strong> Hauptmulde und Hainsberg-<br />
Quohrener Nebenmulde in zwei Kolumnen beschrieben<br />
worden (REICHEL 1966, 1970). Da<strong>bei</strong> wurde der klassische<br />
Begriff „Brekzientuffe“ (SAUER & BECK 1891) wegen fluviatiler<br />
Bänke mit einer Kennzeichnung des Gefüges durch<br />
„Brekziöse Konglomerate“ ersetzt. Die seit 1966 gebräuchliche<br />
und bewährte Gliederung in Unteren und Oberen<br />
Konglomerathorizont kann, entgegen anderer Ansicht<br />
(SCHNEIDER & GÖBEL 1999: 55), aufrechterhalten werden,<br />
wenn man die zahlreichen aussagekräftigen Querschnitte<br />
verwendet und eine Feinkartierung der Weißeritzhänge<br />
berücksichtigt.<br />
Es werden daher die neutralen Begriffe „Unteres Vulkanitfanglomerat“<br />
und „Oberes Vulkanitfanglomerat“ verwendet,<br />
die eine Kennzeichnung der Hauptkomponenten<br />
und der Genese verdeutlichen. Beide Horizonte gehen im<br />
Weißeritztal in Gneis-Rhyolith Konglomerate über. <strong>Das</strong><br />
untere Konglomerat steht an der Cossmannsdorfer Brücke<br />
an, das obere beginnt etwa 5 m über Straßenniveau am<br />
Backofenfelsen <strong>bei</strong> Hainsberg und ist von der gegenüberliegenden<br />
Talseite gut zu erkennen.<br />
In den „Gebänderten Sandschiefer-Arkose-Schichten“<br />
(1966) können lokal Pyroklastitlagen auftreten. Die<br />
gebrauchte Bezeichnung „Gittersee-Pyroklastit-Mem-ber“<br />
ist sowohl von der Lokalität als auch von der Lithologie<br />
unzutreffend. Der größte Aufschluss des gesamten<br />
<strong>Becken</strong>s, die Wände am Backofenfelsen (Abb. 3.4-1), wurde<br />
bisher übersehen und nicht zur Charakterisierung benutzt.