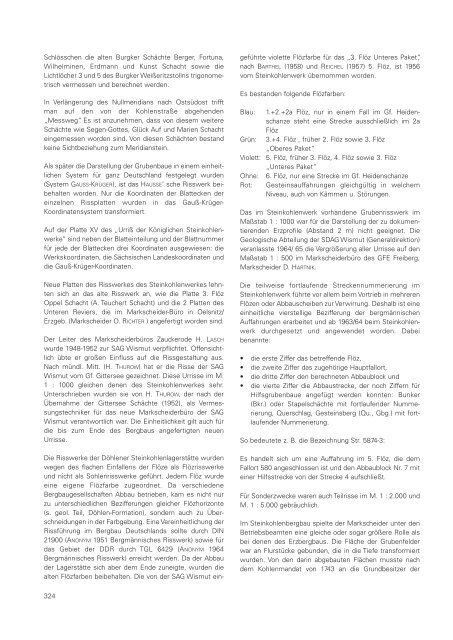Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Schlösschen die alten Burgker Schächte Berger, Fortuna,<br />
Wilhelminen, Erdmann und Kunst Schacht sowie die<br />
Lichtlöcher 3 und 5 des Burgker Weißeritzstollns trigonometrisch<br />
vermessen und berechnet werden.<br />
In Verlängerung des Nullmeridians nach Ostsüdost trifft<br />
man auf den von der Kohlenstraße abgehenden<br />
„Messweg“. Es ist anzunehmen, dass von diesem weitere<br />
Schächte wie Segen-Gottes, Glück Auf und Marien Schacht<br />
eingemessen worden sind. Von diesen Schächten bestand<br />
keine Sichtbeziehung zum Meridianstein.<br />
Als später die Darstellung der Grubenbaue in einem einheitlichen<br />
System für ganz Deutschland festgelegt wurden<br />
(System GAUSS-KRÜGER), ist das HAUSSE’ sche Risswerk <strong>bei</strong>behalten<br />
worden. Nur die Koordinaten der Blattecken der<br />
einzelnen Rissplatten wurden in das Gauß-Krüger-<br />
Koordinatensystem transformiert.<br />
Auf der Platte XV des „Urriß der Königlichen Steinkohlenwerke“<br />
sind neben der Blatteinteilung und der Blattnummer<br />
für jede der Blattecken drei Koordinaten ausgewiesen: die<br />
Werkskoordinaten, die Sächsischen Landeskoordinaten und<br />
die Gauß-Krüger-Koordinaten.<br />
Neue Platten des Risswerkes des Steinkohlenwerkes lehnten<br />
sich an das alte Risswerk an, wie die Platte 3. Flöz<br />
Oppel Schacht (A. Teuchert Schacht) und die 2 Platten des<br />
Unteren Reviers, die im Markscheider-Büro in Oelsnitz/<br />
Erzgeb. (Markscheider O. RICHTER ) angefertigt worden sind.<br />
Der Leiter des Markscheiderbüros Zauckerode H. LASCH<br />
wurde 1948-1952 zur SAG Wismut verpflichtet. Offensichtlich<br />
übte er großen Einfluss auf die Rissgestaltung aus.<br />
Nach mündl. Mitt. (H. THUROW) hat er die Risse der SAG<br />
Wismut vom Gf. Gittersee gezeichnet. Diese Urrisse im M.<br />
1 : 1000 gleichen denen des Steinkohlenwerkes sehr.<br />
Unterschrieben wurden sie von H. THUROW, der nach der<br />
Übernahme der Gittersee Schächte (1952), als Vermessungstechniker<br />
für das neue Markscheiderbüro der SAG<br />
Wismut verantwortlich war. Die Einheitlichkeit gilt auch für<br />
die bis zum Ende des <strong>Bergbau</strong>s angefertigten neuen<br />
Urrisse.<br />
Die Risswerke der <strong>Döhlener</strong> Steinkohlenlagerstätte wurden<br />
wegen des flachen Einfallens der Flöze als Flözrisswerke<br />
und nicht als Sohlenrisswerke geführt. Jedem Flöz wurde<br />
eine eigene Flözfarbe zugeordnet. Da verschiedene<br />
<strong>Bergbau</strong>gesellschaften Abbau betrieben, kam es nicht nur<br />
zu unterschiedlichen Bezifferungen gleicher Flözhorizonte<br />
(s. geol. Teil, Döhlen-Formation), sondern auch zu Überschneidungen<br />
in der Farbgebung. Eine Vereinheitlichung der<br />
Rissführung im <strong>Bergbau</strong> Deutschlands sollte durch DIN<br />
21900 (ANONYM 1951 Bergmännisches Risswerk) sowie für<br />
das Gebiet der DDR durch TGL 6429 (ANONYM 1964<br />
Bergmännisches Risswerk) erreicht werden. Da der Abbau<br />
der Lagerstätte sich aber dem Ende zuneigte, wurden die<br />
alten Flözfarben <strong>bei</strong>behalten. Die von der SAG Wismut ein-<br />
324<br />
geführte violette Flözfarbe für das „3. Flöz Unteres Paket“,<br />
nach BARTHEL (1958) und REICHEL (1957) 5. Flöz, ist 1956<br />
vom Steinkohlenwerk übernommen worden.<br />
Es bestanden folgende Flözfarben:<br />
Blau: 1.+2.+2a Flöz, nur in einem Fall im Gf. Heidenschanze<br />
steht eine Strecke ausschließlich im 2a<br />
Flöz<br />
Grün: 3.+4. Flöz , früher 2. Flöz sowie 3. Flöz<br />
„Oberes Paket“<br />
Violett: 5. Flöz, früher 3. Flöz, 4. Flöz sowie 3. Flöz<br />
„Unteres Paket“<br />
Ohne: 6. Flöz, nur eine Strecke im Gf. Heidenschanze<br />
Rot: Gesteinsauffahrungen gleichgültig in welchem<br />
Niveau, auch von Kämmen u. Störungen.<br />
<strong>Das</strong> im Steinkohlenwerk vorhandene Grubenrisswerk im<br />
Maßstab 1 : 1000 war für die Darstellung der zu dokumentierenden<br />
Erzprofile (Abstand 2 m) nicht geeignet. Die<br />
Geologische Abteilung der SDAG Wismut (Generaldirektion)<br />
veranlasste 1964/ 65 die Vergrößerung aller Urrisse auf den<br />
Maßstab 1 : 500 im Markscheiderbüro des GFE Freiberg,<br />
Markscheider D. HARTNIK.<br />
Die teilweise fortlaufende Streckennummerierung im<br />
Steinkohlenwerk führte vor allem <strong>bei</strong>m Vortrieb in mehreren<br />
Flözen oder Abbauscheiben zur Verwirrung. Deshalb ist eine<br />
einheitliche vierstellige Bezifferung der bergmännischen<br />
Auffahrungen erar<strong>bei</strong>tet und ab 1963/64 <strong>bei</strong>m Steinkohlenwerk<br />
durchgesetzt und angewendet worden. Da<strong>bei</strong><br />
benannte:<br />
• die erste Ziffer das betreffende Flöz,<br />
• die zweite Ziffer das zugehörige Hauptfallort,<br />
• die dritte Ziffer den berechneten Abbaublock und<br />
• die vierte Ziffer die Abbaustrecke, der noch Ziffern für<br />
Hilfsgrubenbaue angefügt werden konnten: Bunker<br />
(Bkr.) oder Stapelschächte mit fortlaufender Nummerierung,<br />
Querschlag, Gesteinsberg (Qu., Gbg.) mit fortlaufender<br />
Nummerierung.<br />
So bedeutete z. B. die Bezeichnung Str. 5874-3:<br />
Es handelt sich um eine Auffahrung im 5. Flöz, die dem<br />
Fallort 580 angeschlossen ist und den Abbaublock Nr. 7 mit<br />
einer Hilfsstrecke von der Strecke 4 aufschließt.<br />
Für Sonderzwecke waren auch Teilrisse im M. 1 : 2.000 und<br />
M. 1 : 5.000 gebräuchlich.<br />
Im Steinkohlenbergbau spielte der Markscheider unter den<br />
Betriebsbeamten eine gleiche oder sogar größere Rolle als<br />
<strong>bei</strong> denen des Erzbergbaus. Die Fläche der Grubenfelder<br />
war an Flurstücke gebunden, die in die Tiefe transformiert<br />
wurden. Von den darin abgebauten Flächen musste nach<br />
dem Kohlenmandat von 1743 an die Grundbesitzer der