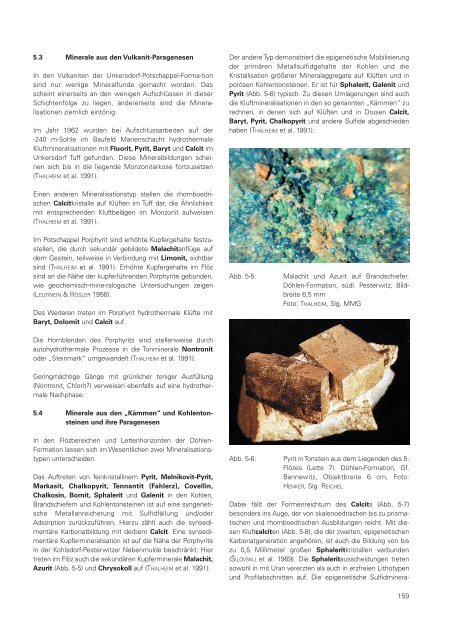Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
5.3 Minerale aus den Vulkanit-Paragenesen<br />
In den Vulkaniten der Unkersdorf-Potschappel-Forma-tion<br />
sind nur wenige Mineralfunde gemacht worden. <strong>Das</strong><br />
scheint einerseits an den wenigen Aufschlüssen in dieser<br />
Schichtenfolge zu liegen, andererseits sind die Mineralisationen<br />
ziemlich eintönig.<br />
Im Jahr 1962 wurden <strong>bei</strong> Aufschlussar<strong>bei</strong>ten auf der<br />
-240 m-Sohle im Baufeld Marienschacht hydrothermale<br />
Kluftmineralisationen mit Fluorit, Pyrit, Baryt und Calcit im<br />
Unkersdorf Tuff gefunden. Diese Mineralbildungen scheinen<br />
sich bis in die liegende Monzonitarkose fortzusetzen<br />
(THALHEIM et al. 1991).<br />
Einen anderen Mineralisationstyp stellen die rhomboedrischen<br />
Calcitkristalle auf Klüften im Tuff dar, die Ähnlichkeit<br />
mit entsprechenden Kluftbelägen im Monzonit aufweisen<br />
(THALHEIM et al. 1991).<br />
Im Potschappel Porphyrit sind erhöhte Kupfergehalte festzustellen,<br />
die durch sekundär gebildete Malachitanflüge auf<br />
dem Gestein, teilweise in Verbindung mit Limonit, sichtbar<br />
sind (THALHEIM et al. 1991). Erhöhte Kupfergehalte im Flöz<br />
sind an die Nähe der kupferführenden Porphyrite gebunden,<br />
wie geochemisch-mine-ralogische Untersuchungen zeigen<br />
(LEUTWEIN & RÖSLER 1956).<br />
Des Weiteren treten im Porphyrit hydrothermale Klüfte mit<br />
Baryt, Dolomit und Calcit auf.<br />
Die Hornblenden des Porphyrits sind stellenweise durch<br />
autohydrothermale Prozesse in die Tonminerale Nontronit<br />
oder „Steinmark“ umgewandelt (THALHEIM et al. 1991).<br />
Geringmächtige Gänge mit grünlicher toniger Ausfüllung<br />
(Nontronit, Chlorit?) verweisen ebenfalls auf eine hydrothermale<br />
Nachphase.<br />
5.4 Minerale aus den „Kämmen“ und Kohlentonsteinen<br />
und ihre Paragenesen<br />
In den Flözbereichen und Lettenhorizonten der Döhlen-<br />
Formation lassen sich im Wesentlichen zwei Mineralisationstypen<br />
unterscheiden.<br />
<strong>Das</strong> Auftreten von feinkristallinem Pyrit, Melnikovit-Pyrit,<br />
Markasit, Chalkopyrit, Tennantit (Fahlerz), Covellin,<br />
Chalkosin, Bornit, Sphalerit und Galenit in den Kohlen,<br />
Brandschiefern und Kohlentonsteinen ist auf eine syngenetische<br />
Metallanreicherung mit Sulfidfällung und/oder<br />
Adsorption zurückzuführen. Hierzu zählt auch die synsedimentäre<br />
Karbonatbildung mit derbem Calcit. Eine synsedimentäre<br />
Kupfermineralisation ist auf die Nähe der Porphyrite<br />
in der Kohlsdorf-Pesterwitzer Nebenmulde beschränkt. Hier<br />
treten im Flöz auch die sekundären Kupferminerale Malachit,<br />
Azurit (Abb. 5-5) und Chrysokoll auf (THALHEIM et al. 1991).<br />
Der andere Typ demonstriert die epigenetische Mobilisierung<br />
der primären Metallsulfidgehalte der Kohlen und die<br />
Kristallisation größerer Mineralaggregate auf Klüften und in<br />
porösen Kohlentonsteinen. Er ist für Sphalerit, Galenit und<br />
Pyrit (Abb. 5-6) typisch. Zu diesen Umlagerungen sind auch<br />
die Kluftmineralisationen in den so genannten „Kämmen“ zu<br />
rechnen, in denen sich auf Klüften und in Drusen Calcit,<br />
Baryt, Pyrit, Chalkopyrit und andere Sulfide abgeschieden<br />
haben (THALHEIM et al. 1991).<br />
Abb. 5-5: Malachit und Azurit auf Brandschiefer.<br />
Döhlen-Formation, südl. Pesterwitz, Bildbreite<br />
6,5 mm<br />
Foto: THALHEIM, Slg. MMG<br />
Abb. 5-6: Pyrit in Tonstein aus dem Liegenden des 5.<br />
Flözes (Lette 7). Döhlen-Formation, Gf.<br />
Bannewitz, Objektbreite 6 cm, Foto:<br />
HENKER, Slg. REICHEL<br />
Da<strong>bei</strong> fällt der Formenreichtum des Calcits (Abb. 5-7)<br />
besonders ins Auge, der von skalenoedrischen bis zu prismatischen<br />
und rhomboedrischen Ausbildungen reicht. Mit diesen<br />
Kluftcalciten (Abb. 5-8), die der zweiten, epigenetischen<br />
Karbonatgeneration angehören, ist auch die Bildung von bis<br />
zu 0,5 Millimeter großen Sphaleritkristallen verbunden<br />
(ŠILOVSKIJ et al. 1969). Die Sphaleritausscheidungen treten<br />
sowohl in mit Uran vererzten als auch in erzfreien Lithotypen<br />
und Profilabschnitten auf. Die epigenetische Sulfidminera-<br />
159