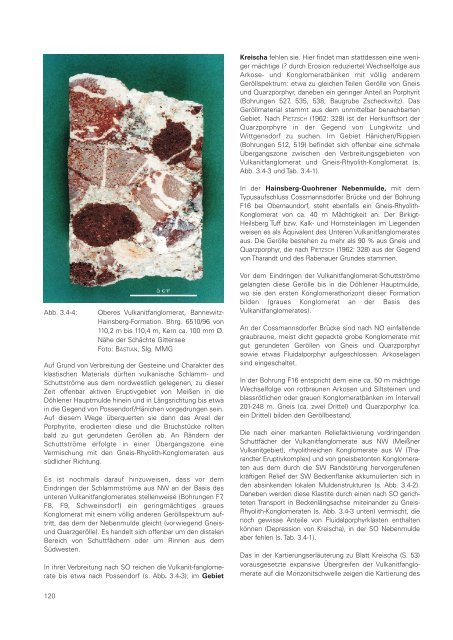Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Abb. 3.4-4: Oberes Vulkanitfanglomerat, Bannewitz-<br />
Hainsberg-Formation. Bhrg. 6510/96 von<br />
110,2 m bis 110,4 m, Kern ca. 100 mm Ø.<br />
Nähe der Schächte Gittersee<br />
Foto: BASTIAN, Slg. MMG<br />
Auf Grund von Verbreitung der Gesteine und Charakter des<br />
klastischen Materials dürften vulkanische Schlamm- und<br />
Schuttströme aus dem nordwestlich gelegenen, zu dieser<br />
Zeit offenbar aktiven Eruptivgebiet von Meißen in die<br />
<strong>Döhlener</strong> Hauptmulde hinein und in Längsrichtung bis etwa<br />
in die Gegend von Possendorf/Hänichen vorgedrungen sein.<br />
Auf diesem Wege überquerten sie dann das Areal der<br />
Porphyrite, erodierten diese und die Bruchstücke rollten<br />
bald zu gut gerundeten Geröllen ab. An Rändern der<br />
Schuttströme erfolgte in einer Übergangszone eine<br />
Vermischung mit den Gneis-Rhyolith-Konglomeraten aus<br />
südlicher Richtung.<br />
Es ist nochmals darauf hinzuweisen, dass vor dem<br />
Eindringen der Schlammströme aus NW an der Basis des<br />
unteren Vulkanitfanglomerates stellenweise (Bohrungen F7,<br />
F8, F9, Schweinsdorf) ein geringmächtiges graues<br />
Konglomerat mit einem völlig anderen Geröllspektrum auftritt,<br />
das dem der Nebenmulde gleicht (vorwiegend Gneisund<br />
Quarzgerölle). Es handelt sich offenbar um den distalen<br />
Bereich von Schuttfächern oder um Rinnen aus dem<br />
Südwesten.<br />
In ihrer Verbreitung nach SO reichen die Vulkanit-fanglomerate<br />
bis etwa nach Possendorf (s. Abb. 3.4-3); im Gebiet<br />
120<br />
Kreischa fehlen sie. Hier findet man stattdessen eine weniger<br />
mächtige (? durch Erosion reduzierte) Wechselfolge aus<br />
Arkose- und Konglomeratbänken mit völlig anderem<br />
Geröllspektrum: etwa zu gleichen Teilen Gerölle von Gneis<br />
und Quarzporphyr, daneben ein geringer Anteil an Porphyrit<br />
(Bohrungen 527, 535, 538, Baugrube Zscheckwitz). <strong>Das</strong><br />
Geröllmaterial stammt aus dem unmittelbar benachbarten<br />
Gebiet. Nach PIETZSCH (1962: 328) ist der Herkunftsort der<br />
Quarzporphyre in der Gegend von Lungkwitz und<br />
Wittgensdorf zu suchen. Im Gebiet Hänichen/Rippien<br />
(Bohrungen 512, 519) befindet sich offenbar eine schmale<br />
Übergangszone zwischen den Verbreitungsgebieten von<br />
Vulkanitfanglomerat und Gneis-Rhyolith-Konglomerat (s.<br />
Abb. 3.4-3 und Tab. 3.4-1).<br />
In der Hainsberg-Quohrener Nebenmulde, mit dem<br />
Typusaufschluss Cossmannsdorfer Brücke und der Bohrung<br />
F16 <strong>bei</strong> Obernaundorf, steht ebenfalls ein Gneis-Rhyolith-<br />
Konglomerat von ca. 40 m Mächtigkeit an. Der Birkigt-<br />
Heilsberg Tuff bzw. Kalk- und Hornsteinlagen im Liegenden<br />
weisen es als Äquivalent des Unteren Vulkanitfanglomerates<br />
aus. Die Gerölle bestehen zu mehr als 90 % aus Gneis und<br />
Quarzporphyr, die nach PIETZSCH (1962: 328) aus der Gegend<br />
von Tharandt und des Rabenauer Grundes stammen.<br />
Vor dem Eindringen der Vulkanitfanglomerat-Schuttströme<br />
gelangten diese Gerölle bis in die <strong>Döhlener</strong> Hauptmulde,<br />
wo sie den ersten Konglomerathorizont dieser Formation<br />
bilden (graues Konglomerat an der Basis des<br />
Vulkanitfanglomerates).<br />
An der Cossmannsdorfer Brücke sind nach NO einfallende<br />
graubraune, meist dicht gepackte grobe Konglomerate mit<br />
gut gerundeten Geröllen von Gneis und Quarzporphyr<br />
sowie etwas Fluidalporphyr aufgeschlossen. Arkoselagen<br />
sind eingeschaltet.<br />
In der Bohrung F16 entspricht dem eine ca. 50 m mächtige<br />
Wechselfolge von rotbraunen Arkosen und Siltsteinen und<br />
blassrötlichen oder grauen Konglomeratbänken im Intervall<br />
201-248 m. Gneis (ca. zwei Drittel) und Quarzporphyr (ca.<br />
ein Drittel) bilden den Geröllbestand.<br />
Die nach einer markanten Reliefaktivierung vordringenden<br />
Schuttfächer der Vulkanitfanglomerate aus NW (Meißner<br />
Vulkanitgebiet), rhyolithreichen Konglomerate aus W (Tharandter<br />
Eruptivkomplex) und von gneisbetonten Konglomeraten<br />
aus dem durch die SW Randstörung hervorgerufenen<br />
kräftigen Relief der SW <strong>Becken</strong>flanke akkumulierten sich in<br />
den absinkenden lokalen Muldenstrukturen (s. Abb. 3.4-2).<br />
Daneben werden diese Klastite durch einen nach SO gerichteten<br />
Transport in <strong>Becken</strong>längsachse miteinander zu Gneis-<br />
Rhyolith-Konglomeraten (s. Abb. 3.4-3 unten) vermischt, die<br />
noch gewisse Anteile von Fluidalporphyrklasten enthalten<br />
können (Depression von Kreischa), in der SO Nebenmulde<br />
aber fehlen (s. Tab. 3.4-1).<br />
<strong>Das</strong> in der Kartierungserläuterung zu Blatt Kreischa (S. 53)<br />
vorausgesetzte expansive Übergreifen der Vulkanitfanglomerate<br />
auf die Monzonitschwelle zeigen die Kartierung des