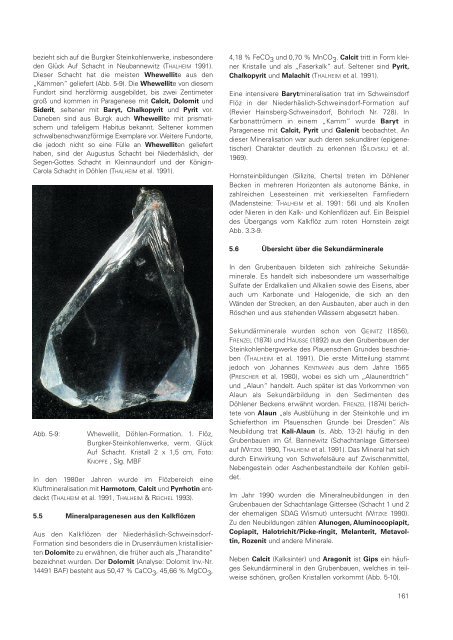Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ezieht sich auf die Burgker Steinkohlenwerke, insbesondere<br />
den Glück Auf Schacht in Neubannewitz (THALHEIM 1991).<br />
Dieser Schacht hat die meisten Whewellite aus den<br />
„Kämmen“ geliefert (Abb. 5-9). Die Whewellite von diesem<br />
Fundort sind herzförmig ausgebildet, bis zwei Zentimeter<br />
groß und kommen in Paragenese mit Calcit, Dolomit und<br />
Siderit, seltener mit Baryt, Chalkopyrit und Pyrit vor.<br />
Daneben sind aus Burgk auch Whewellite mit prismatischem<br />
und tafeligem Habitus bekannt. Seltener kommen<br />
schwalbenschwanzförmige Exemplare vor. Weitere Fundorte,<br />
die jedoch nicht so eine Fülle an Whewelliten geliefert<br />
haben, sind der Augustus Schacht <strong>bei</strong> Niederhäslich, der<br />
Segen-Gottes Schacht in Kleinnaundorf und der Königin-<br />
Carola Schacht in Döhlen (THALHEIM et al. 1991).<br />
Abb. 5-9: Whewellit, Döhlen-Formation. 1. Flöz,<br />
Burgker-Steinkohlenwerke, verm. Glück<br />
Auf Schacht. Kristall 2 x 1,5 cm, Foto:<br />
KNOPFE , Slg. MBF<br />
In den 1980er Jahren wurde im Flözbereich eine<br />
Kluftmineralisation mit Harmotom, Calcit und Pyrrhotin entdeckt<br />
(THALHEIM et al. 1991, THALHEIM & REICHEL 1993).<br />
5.5 Mineralparagenesen aus den Kalkflözen<br />
Aus den Kalkflözen der Niederhäslich-Schweinsdorf-<br />
Formation sind besonders die in Drusenräumen kristallisierten<br />
Dolomite zu erwähnen, die früher auch als „Tharandite“<br />
bezeichnet wurden. Der Dolomit (Analyse: Dolomit Inv.-Nr.<br />
14491 BAF) besteht aus 50,47 % CaCO 3 , 45,66 % MgCO 3 ,<br />
4,18 % FeCO 3 und 0,70 % MnCO 3 . Calcit tritt in Form kleiner<br />
Kristalle und als „Faserkalk“ auf. Seltener sind Pyrit,<br />
Chalkopyrit und Malachit (THALHEIM et al. 1991).<br />
Eine intensivere Barytmineralisation trat im Schweinsdorf<br />
Flöz in der Niederhäslich-Schweinsdorf-Formation auf<br />
(Revier Hainsberg-Schweinsdorf, Bohrloch Nr. 728). In<br />
Karbonattrümern in einem „Kamm“ wurde Baryt in<br />
Paragenese mit Calcit, Pyrit und Galenit beobachtet. An<br />
dieser Mineralisation war auch deren sekundärer (epigenetischer)<br />
Charakter deutlich zu erkennen (ŠILOVSKIJ et al.<br />
1969).<br />
Hornsteinbildungen (Silizite, Cherts) treten im <strong>Döhlener</strong><br />
<strong>Becken</strong> in mehreren Horizonten als autonome Bänke, in<br />
zahlreichen Lesesteinen mit verkieselten Farnfiedern<br />
(Madensteine: THALHEIM et al. 1991: 56) und als Knollen<br />
oder Nieren in den Kalk- und Kohlenflözen auf. Ein Beispiel<br />
des Übergangs vom Kalkflöz zum roten Hornstein zeigt<br />
Abb. 3.3-9.<br />
5.6 Übersicht über die Sekundärminerale<br />
In den Grubenbauen bildeten sich zahlreiche Sekundärminerale.<br />
Es handelt sich insbesondere um wasserhaltige<br />
Sulfate der Erdalkalien und Alkalien sowie des Eisens, aber<br />
auch um Karbonate und Halogenide, die sich an den<br />
Wänden der Strecken, an den Ausbauten, aber auch in den<br />
Röschen und aus stehenden Wässern abgesetzt haben.<br />
Sekundärminerale wurden schon von GEINITZ (1856),<br />
FRENZEL (1874) und HAUSSE (1892) aus den Grubenbauen der<br />
Steinkohlenbergwerke des Plauenschen Grundes beschrieben<br />
(THALHEIM et al. 1991). Die erste Mitteilung stammt<br />
jedoch von Johannes KENTMANN aus dem Jahre 1565<br />
(PRESCHER et al. 1980), wo<strong>bei</strong> es sich um „Alaunerdtrich“<br />
und „Alaun“ handelt. Auch später ist das Vorkommen von<br />
Alaun als Sekundärbildung in den Sedimenten des<br />
<strong>Döhlener</strong> <strong>Becken</strong>s erwähnt worden. FRENZEL (1874) berichtete<br />
von Alaun „als Ausblühung in der Steinkohle und im<br />
Schieferthon im Plauenschen Grunde <strong>bei</strong> <strong>Dresden</strong>“. Als<br />
Neubildung trat Kali-Alaun (s. Abb. 13-2) häufig in den<br />
Grubenbauen im Gf. Bannewitz (Schachtanlage Gittersee)<br />
auf (WITZKE 1990, THALHEIM et al. 1991). <strong>Das</strong> Mineral hat sich<br />
durch Einwirkung von Schwefelsäure auf Zwischenmittel,<br />
Nebengestein oder Aschenbestandteile der Kohlen gebildet.<br />
Im Jahr 1990 wurden die Mineralneubildungen in den<br />
Grubenbauen der Schachtanlage Gittersee (Schacht 1 und 2<br />
der ehemaligen SDAG Wismut) untersucht (WITZKE 1990).<br />
Zu den Neubildungen zählen Alunogen, Aluminocopiapit,<br />
Copiapit, Halotrichit/Picke-ringit, Melanterit, Metavoltin,<br />
Rozenit und andere Minerale.<br />
Neben Calcit (Kalksinter) und Aragonit ist Gips ein häufiges<br />
Sekundärmineral in den Grubenbauen, welches in teilweise<br />
schönen, großen Kristallen vorkommt (Abb. 5-10).<br />
161