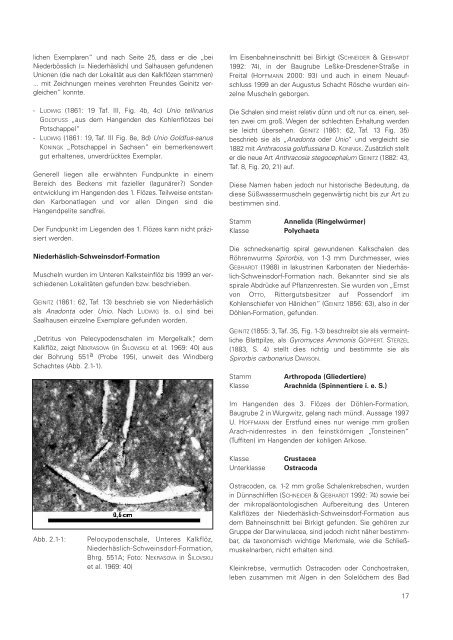Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
lichen Exemplaren“ und nach Seite 25, dass er die „<strong>bei</strong><br />
Niederbösslich (= Niederhäslich) und Salhausen gefundenen<br />
Unionen (die nach der Lokalität aus den Kalkflözen stammen)<br />
... mit Zeichnungen meines verehrten Freundes Geinitz vergleichen“<br />
konnte.<br />
- LUDWIG (1861: 19 Taf. III, Fig. 4b, 4c) Unio tellinarius<br />
GOLDFUSS „aus dem Hangenden des Kohlenflötzes <strong>bei</strong><br />
Potschappel“<br />
- LUDWIG (1861: 19, Taf. III Fig. 8e, 8d) Unio Goldfus-sanus<br />
KONINGK „Potschappel in Sachsen“ ein bemerkenswert<br />
gut erhaltenes, unverdrücktes Exemplar.<br />
Generell liegen alle erwähnten Fundpunkte in einem<br />
Bereich des <strong>Becken</strong>s mit fazieller (lagunärer?) Sonderentwicklung<br />
im Hangenden des 1. Flözes. Teilweise entstanden<br />
Karbonatlagen und vor allen Dingen sind die<br />
Hangendpelite sandfrei.<br />
Der Fundpunkt im Liegenden des 1. Flözes kann nicht präzisiert<br />
werden.<br />
Niederhäslich-Schweinsdorf-Formation<br />
Muscheln wurden im Unteren Kalksteinflöz bis 1999 an verschiedenen<br />
Lokalitäten gefunden bzw. beschrieben.<br />
GEINITZ (1861: 62, Taf. 13) beschrieb sie von Niederhäslich<br />
als Anadonta oder Unio. Nach LUDWIG (s. o.) sind <strong>bei</strong><br />
Saalhausen einzelne Exemplare gefunden worden.<br />
„Detritus von Pelecypodenschalen im Mergelkalk“, dem<br />
Kalkflöz, zeigt NEKRASOVA (in ŠILOWSKIJ et al. 1969: 40) aus<br />
der Bohrung 551 a (Probe 195), unweit des Windberg<br />
Schachtes (Abb. 2.1-1).<br />
Abb. 2.1-1: Pelocypodenschale, Unteres Kalkflöz,<br />
Niederhäslich-Schweinsdorf-Formation,<br />
Bhrg. 551A; Foto: NEKRASOVA in ŠILOVSKIJ<br />
et al. 1969: 40)<br />
Im Eisenbahneinschnitt <strong>bei</strong> Birkigt (SCHNEIDER & GEBHARDT<br />
1992: 74), in der Baugrube Leßke-<strong>Dresden</strong>er-Straße in<br />
Freital (HOFFMANN 2000: 93) und auch in einem Neuaufschluss<br />
1999 an der Augustus Schacht Rösche wurden einzelne<br />
Muscheln geborgen.<br />
Die Schalen sind meist relativ dünn und oft nur ca. einen, selten<br />
zwei cm groß. Wegen der schlechten Er-haltung werden<br />
sie leicht übersehen. GEINITZ (1861: 62, Taf. 13 Fig. 35)<br />
beschrieb sie als „Anadonta oder Unio“ und vergleicht sie<br />
1882 mit Anthracosia goldfussiana D. KONINGK. Zusätzlich stellt<br />
er die neue Art Anthracosia stegocephalum GEINITZ (1882: 43,<br />
Taf. 8, Fig. 20, 21) auf.<br />
Diese Namen haben jedoch nur historische Bedeutung, da<br />
diese Süßwassermuscheln gegenwärtig nicht bis zur Art zu<br />
bestimmen sind.<br />
Stamm Annelida (Ringelwürmer)<br />
Klasse Polychaeta<br />
Die schneckenartig spiral gewundenen Kalkschalen des<br />
Röhrenwurms Spirorbis, von 1-3 mm Durchmesser, wies<br />
GEBHARDT (1988) in lakustrinen Karbonaten der Niederhäslich-Schweinsdorf-Formation<br />
nach. Bekannter sind sie als<br />
spirale Abdrücke auf Pflanzenresten. Sie wurden von „Ernst<br />
von OTTO, Rittergutsbesitzer auf Possendorf im<br />
Kohlenschiefer von Hänichen“ (GEINITZ 1856: 63), also in der<br />
Döhlen-Formation, gefunden.<br />
GEINITZ (1855: 3, Taf. 35, Fig. 1-3) beschreibt sie als vermeintliche<br />
Blattpilze, als Gyromyces Ammonis GÖPPERT. STERZEL<br />
(1883, S. 4) stellt dies richtig und bestimmte sie als<br />
Spirorbis carbonarius DAWSON.<br />
Stamm Arthropoda (Gliedertiere)<br />
Klasse Arachnida (Spinnentiere i. e. S.)<br />
Im Hangenden des 3. Flözes der Döhlen-Formation,<br />
Baugrube 2 in Wurgwitz, gelang nach mündl. Aussage 1997<br />
U. HOFFMANN der Erstfund eines nur wenige mm großen<br />
Arach-nidenrestes in den feinstkörnigen „Tonsteinen“<br />
(Tuffiten) im Hangenden der kohligen Arkose.<br />
Klasse Crustacea<br />
Unterklasse Ostracoda<br />
Ostracoden, ca. 1-2 mm große Schalenkrebschen, wurden<br />
in Dünnschliffen (SCHNEIDER & GEBHARDT 1992: 74) sowie <strong>bei</strong><br />
der mikropaläontologischen Aufbereitung des Unteren<br />
Kalkflözes der Niederhäslich-Schweinsdorf-Formation aus<br />
dem Bahneinschnitt <strong>bei</strong> Birkigt gefunden. Sie gehören zur<br />
Gruppe der Darwinulacea, sind jedoch nicht näher bestimmbar,<br />
da taxonomisch wichtige Merkmale, wie die Schließmuskelnarben,<br />
nicht erhalten sind.<br />
Kleinkrebse, vermutlich Ostracoden oder Conchostraken,<br />
leben zusammen mit Algen in den Solelöchern des Bad<br />
17